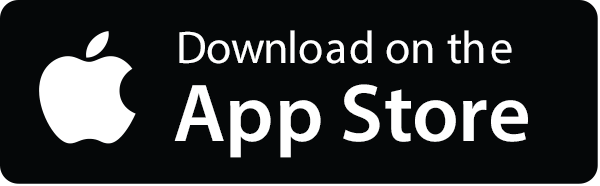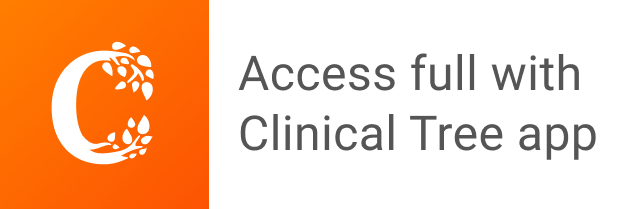Holger SalgeAnalytische Psychotherapie zwischen 18 und 252013Besonderheiten in der Behandlung von Spätadoleszenten10.1007/978-3-642-35357-4_7© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
7. Behandlungstechnische Gesichtspunkte
(1)
Fachklinik f. analytische Pschotherapie, Sonnenberg Klinik, Christian-Belser-Str. 79, 70597 Stuttgart, Deutschland
Zusammenfassung
Wenn die Behandlung spätadoleszenter Patienten unabhängig von der im Vordergrund stehenden Symptomatik oder Störung immer auch auf die Wiederherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten abzielt, muss das therapeutische Vorgehen an den drei folgenden Fragen orientiert bleiben:
1.
Aufgrund welcher innerer Konflikte und/oder struktureller Defizite muss ein junger Mensch in dieser Lebensphase seine eigene Entwicklung verlangsamen, boykottieren oder attackieren?
2.
Auf welche Weise und mit welchem inneren Gewinn tut er das?
3.
In welchem Bezug zu seiner inneren Objektwelt ist diese Entwicklung zu betrachten?
„Möchten dies doch all diejenigen erwägen, welche irgend jemandem Wohltaten erzeigen wollen, und sich vorher recht prüfen, ob sie sich auch so dabei nehmen werden, dass ihre gutgemeinte Entschliessung dem Bedürftigen nie zur Qual gereiche.“
Karl Philipp Moritz
7.1 Allgemeine Aspekte
Wenn die Behandlung spätadoleszenter Patienten unabhängig von der im Vordergrund stehenden Symptomatik oder Störung immer auch auf die Wiederherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten abzielt, muss das therapeutische Vorgehen an den drei folgenden Fragen orientiert bleiben:
1.
Aufgrund welcher innerer Konflikte und/oder struktureller Defizite muss ein junger Mensch in dieser Lebensphase seine eigene Entwicklung verlangsamen, boykottieren oder attackieren?
2.
Auf welche Weise und mit welchem inneren Gewinn tut er das?
3.
In welchem Bezug zu seiner inneren Objektwelt ist diese Entwicklung zu betrachten?
Ich möchte dabei zunächst einige allgemeine Phänomene benennen, die zwar nicht regelmäßig auftreten, aber bei der Behandlung Spätadoleszenter gehäuft beobachtet werden können und unabhängig vom gewählten Behandlungssetting Beachtung verdienen.
Festhalten am Selbstentwurf
Aufgrund ihrer Entwicklungshemmung einerseits und den reiferen Möglichkeiten des Denkens und Reflektierens andererseits sind junge Erwachsene sehr viel mehr als Jugendliche für die Aufrechterhaltung ihres inneren Gleichgewichts und zur Bewältigung von Beschämungsbedrohungen darauf angewiesen, ihrer Umgebung und in erster Linie natürlich sich selbst die prekäre eigene Situation „zu erklären“. Der Therapeut oder das therapeutische Team sehen sich häufig mit einem starren, legitimationsvermittelnden Selbstentwurf konfrontiert, an dem der Patient verbissen und zunächst recht unbeirrbar festhält. Die Möglichkeit der Flexibilisierung dieses Selbstentwurfs im Verlauf der Behandlung kann dabei durchaus als prognostischer Faktor Würdigung finden. Insofern geraten diese Patienten durch die mit einer analytischen oder tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie implizit verbundene Aufforderung zur Selbstoffenbarung in eine prekäre Situation. Die bewussten Konzepte zur Erklärung des eigenen Selbst bzw. zum eigenen Gewordensein haben häufig einen rechtfertigenden Charakter und dienen in erster Linie der Beruhigung, der Entschuldigung und damit auch der Schamabwehr. Die mit der Psychotherapie verbundene Anerkennung eines schon länger geübten Verzichts auf die Suche nach der persönlichen Wahrheit stellt einen weiteren Angriff auf die schon labilisierte Selbstachtung dar. Da sich diese Entwicklung vor dem Hintergrund einer insgesamt unsicheren Identität und ohne eine stabile Bezugnahme auf eigene Lebensleistungen abspielt (und falls vorhanden, werden sie nicht entsprechend interpretiert und für die innere Stabilisierung verwendet), gibt sich der besondere Zumutungscharakter von Psychotherapie in dieser Lebensphase ganz unmittelbar zu erkennen.
Die Zumutung des Unbewussten
Die Vorstellung eines im eigenen Inneren zu lokalisierenden Unbewussten mit weitreichender Einflussnahme auf das eigene Leben löst während der Behandlung regelmäßig große Beunruhigung aus. Die Konzeption der eigenen Person bleibt im Dienste der Vermeidung der Begegnung mit der inneren Welt daher zunächst starr, flach und eindimensional. Die Wahrnehmung oder Mitteilung von eigenen Wünschen und Impulsen scheint oftmals bedrohlich. Die Wahrnehmungsschwierigkeiten beziehen sich besonders zum Beginn einer Behandlung in erster Linie auf die begehrenden, fühlenden und wollenden Anteile der Persönlichkeit.
Im Behandlungsprozess besteht zunächst fast regelhaft eine ausgeprägte, mitunter sogar verzweifelt anmutende Bemühung, die eigenen Lebensschwierigkeiten auf der Handlungsebene zu lösen, das eigene Selbst somit aus dem therapeutischen Prozess „herauszuhalten“. Die notwendige Anerkennung, dass der Konflikt eben nicht allein äußerlich lösbar ist, sondern dass der therapeutische Fortschritt eine Bezugnahme auf die eigene Innenwelt, d. h. eine Bezugnahme auf den eigenen Beitrag zu den persönlichen Lebensschwierigkeiten, erfordert, mobilisiert in der Regel erheblichen Widerstand.
Das Aufsichgestelltsein
Es richtet sich während der Psychotherapie ein massiver Widerstand gegen die Anerkennung der Tatsache, in zunehmendem Maße auf sich selbst gestellt zu sein. Das Ausmaß des inneren und äußeren Aufwands, der sich gegen diese Wahrnehmung stemmt, ist oft beeindruckend.
Die Omnipotenz
Das Festhalten an omnipotenten Vorstellungen als wichtigem Stabilisator für das psychische Gleichgewicht kann meist erst in fortgeschrittenen Behandlungsabschnitten hinterfragt und aufgegeben werden.
Die Therapie als Moratorium
Die Behandlung selbst wird unbemerkt vom Patienten (und evtl. auch vom Therapeuten) zu einem (unproduktiven) Moratorium umgestaltet. Insofern ist es, wie auch im äußeren Leben, nicht selbstverständlich, dass dieses Moratorium vom spätadoleszenten Patienten für Entwicklungsschritte genutzt wird. Die Schwierigkeiten der Differenzierung zwischen notwendiger Regression und Vermeidung möglicher Progression bleiben ständiger Begleiter im Behandlungsverlauf.
Die Position der Unschuld
Aus den vorangegangenen Punkten wird verständlich, dass das Festhalten an einer Position der Unschuld eine große Attraktivität mit sich bringt. Die Anerkennung eines eigenen Beitrags zu den bestehenden Konflikten, zu Gewalt, Konkurrenz und Rivalität, zu der Wucht der eigenen Wünsche und fehlender Verantwortungsübernahme kann mit der Aufrechterhaltung dieser Position recht mühelos vermieden werden. Im therapeutischen Diskurs wird dies an der auffällig häufigen Verwendung der Floskel „keine Ahnung“ erkennbar.
Die Therapie als Kränkung
Nicht nur aus den entwicklungspsychologischen Besonderheiten dieser Lebensphase wird deutlich, dass die Notwendigkeit, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, in jedem Setting eine Kränkung darstellt. Im günstigen Fall kann diese Kränkung erlebt und auch formuliert werden. Häufiger verbleibt sie jedoch in der Latenz und äußert sich in einem diffusen Ressentiment gegen den Therapeuten und/oder gegen das therapeutische Setting, das dann in Form von Agieren in Erscheinung tritt.
Es gibt eine Vielzahl von Aspekten des äußeren Lebens, die auf eine arretierte Entwicklung des jungen Erwachsenen hindeuten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind im Folgenden einige besonders häufig zu beobachtende Erscheinungsformen aufgeführt. Hinweise auf eine arretierte Entwicklung sind:
fehlende Integration in die Peergroup;
keine längeren Trennungen von der Primärfamilie bis weit in das zweite Lebensjahrzehnt hinein;
andere Hinweise auf starke Bindung an die Herkunftsfamilie, besonders Aspekte von Partnerersatzfunktionen einem Elternteil gegenüber;
Verzicht auf eine altersgemäße Hinwendung zum anderen Geschlecht/zu sexuellen Aktivitäten;
Fehlen eines authentisch erscheinenden eigenen Lebensentwurfs;
Persistenz von Omnipotenz und Grandiositätsvorstellungen;
Verzicht auf einen ausprobierenden Umgang mit den eigenen Kompetenzen und Schwächen;
Bevorzugung einzelgängerischer Tätigkeiten;
starke Dominanz von virtuellen Kontakten gegenüber realen Freundschaften.
Die Behandlung Adoleszenter und Spätadoleszenter ist Therapie im Übergang. Diese Tatsache findet ihre Widerspiegelung unmittelbar in der Organisation und Realität der psychotherapeutischen Versorgungslandschaft. Spätadoleszente Patienten sind einerseits zu alt für die Behandlung bei Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und treffen bei Erwachsenentherapeuten, wie schon erwähnt, aus verschiedenen Gründen auf erhebliche Vorbehalte.
Gleichzeitig unterliegt die Psychotherapie Spätadoleszenter einem Paradox, das grundsätzlich nicht aufzulösen ist. Der Patient soll in einer Lebensphase, die durch das Ringen um Ablösung, Individuation und Verselbstständigung gekennzeichnet ist, eine verbindliche Beziehung eingehen, die Abhängigkeitsgefühle mobilisiert. Daraus ergeben sich erhebliche Konsequenzen für die Behandlungstechnik.
Wenn es im jungen Erwachsenenalter für einen Patienten aus inneren Gründen notwendig geworden ist, den eigenen Fortschritt zu verlangsamen oder auch ganz zu unterbrechen, müssen die therapeutischen Interventionen in erster Linie auf die Verflüssigung der erstarrten Entwicklungsprozesse zielen.
Im folgenden Abschnitt möchte ich einige behandlungstechnische Aspekte, die ich für die Behandlung jüngerer Menschen als besonders bedeutsam empfinde, herausarbeiten.
Grundlage: Rahmenvereinbarung
Behandlungsgrundlage, eigentlich selbstverständlich für jede Form von Psychotherapie, in der Behandlung Spätadoleszenter jedoch von besonderer Wichtigkeit, ist die Etablierung eines klar definierten Rahmens . Dieser konstituiert sich aus wenigen, aber umso klareren Vereinbarungen, die unbedingt vor Aufnahme der Psychotherapie zu treffen sind. Die Verständigung über diese verbindlichen Vereinbarungen betont die Autonomie und Eigenständigkeit des Patienten und besonders seine (Mit-)Verantwortung für den therapeutischen Prozess. Gleichzeitig sind entsprechende Vereinbarungen auch ein notwendiger Versuch, der Neigung jüngerer Patienten entgegenzutreten, die therapeutische Beziehung entlang des Eltern-Kind-Modells oder des Lehrer-Schüler-Modells zu konzeptionalisieren.
Dabei kann nicht genug betont werden, wie fundamental es ist, dass diese Vereinbarungen von beiden Partnern des therapeutischen Prozesses geachtet und ernst genommen werden. Auch kleine Attacken auf den Rahmen durch den Patienten, aber auch durch Versäumnisse des Therapeuten sollten nicht unkommentiert bleiben. Damit ist nicht die Einnahme einer vorwürflichen, gekränkten oder autoritären Haltung gemeint. Die Verspätung, die unbezahlt gebliebene Rechnung, die fehlende Überweisung sollten zeitnah markiert werden und auf ihren Mitteilungsaspekt hin untersucht werden. (Spät-)Adoleszente Patienten achten, selten offen mitgeteilt, meist eher heimlich ausgesprochen stark auf den Umgang des Therapeuten mit Vereinbarungen, fehlendes Engagement, Verwässerungen des therapeutischen Prozesses und Grenzverletzungen. Dem Rahmen kann in diesem Sinne die wichtige Funktion des Dritten zukommen, damit erhält er eine triangulierende Funktion.
Interventionen
Interventionen, die auf die Identitätsunsicherheit (die immer auch die Überwindung der damit verbundenen Schwierigkeiten durch Entwicklung implizieren), auf die damit verbundenen Ablösungsschwierigkeiten, Macht-/Ohnmachtverwicklungen und auch strenge oder gar quälende Über-Ich-Konfigurationen oder unerreichbare Ich-Ideal-Forderungen Bezug nehmen, sind gegenüber Übertragungsdeutungen (zunächst) zu bevorzugen. Übertragungsdeutungen sind – zumindest in Anfangsphasen von Behandlungen – oft ausgesprochen beunruhigend und werden in aller Regel als gegen die Autonomiestrebungen gerichtet erlebt. Eine relativ gefahrlose Regression auf die infantile Position ist für den spätadoleszenten jungen Menschen in der Behandlungsposition eben nicht möglich. Dagegen richten sich regelhaft das so häufig zu beobachtende agierende Verhalten und die ebenso häufigen, mitunter weniger gut erkennbaren maniformen Bewegungen. Junge Patienten sind in der ausgesprochen schwierigen Situation, dass sie einerseits eine Labilisierung durch die Behandlung tolerieren müssen, gleichzeitig ihr inneres Gleichgewicht und äußeres Funktionieren unter dem Erleben innerer Turbulenzen und Identitätsunsicherheiten aufrechterhalten müssen, um die Rückgewinnung ihrer Entwicklungsfähigkeit zu erreichen. Mitunter verwenden junge Erwachsene einen großen Teil der zur Verfügung stehenden Energie für die Aufrechterhaltung ihres seelischen Gleichgewichts, ohne allerdings wahrnehmen zu können, dass dies nur um den Preis der Erstarrung ihrer eigenen Entwicklung gelingt.
Fallvignette
Herr P., ein 22-jähriger und massiv übergewichtiger Patient, schildert im ambulanten Vorgespräch sein persönliches Lebens- oder besser Rückzugsarrangement sehr anschaulich. Bei ausgeprägter intellektueller Begabung lebt er, ohne einer regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen, mit seinen beiden jüngeren Geschwistern im Haus der Eltern (formal war er als Student der Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben). In den zwei Jahren seit seinem Abitur ist es ihm gelungen, sich in einem omnipotent organisierten Raum einzurichten, in dem er völlig ungehindert, offenbar nur seinen eigenen Regeln verpflichtet, leben kann. Er hat sich weitestgehend vom familiären Leben abgekoppelt, verbringt die Zeit überwiegend in seinem Zimmer vor dem PC und fühlt sich auf diese Weise mit der Außenwelt verbunden. Das Haus verlässt er lediglich, um den Nachschub an Süßigkeiten sicherzustellen, die er in seinem Zimmer stets in größeren Mengen gelagert hat. Er bleibt regelmäßig bis in die frühen Morgenstunden wach, um bis weit in den Nachmittag hinein zu schlafen. So kann er mögliche Begegnungen mit den Eltern und damit den letzten verbliebenen Teil der Realität auf ein Minimum reduzieren. Über Kontakte zu anderen Gleichaltrigen, jenseits der virtuellen Welt, verfügt er nicht mehr. Im Vorgespräch wird ein Leidensdruck lediglich hinsichtlich des massiven Übergewichts deutlich, mit seinem sonstigen Lebensarrangement scheint er geradezu einverstanden zu sein.
Bei der theoretischen Konzeption spätadoleszenter Entwicklung und besonders ihrer Behandlung besteht immer die Gefahr, gerade aufgrund der häufig drastisch in Erscheinung tretenden psychosozialen Konsequenzen der dramatischen Symptombildungen den Fokus zu sehr auf die Bewältigung der äußeren Realität zu richten. Fast automatisch erfolgt dann die Fokussierung der Beziehungen zu den realen Objekten der Gegenwart. In behandlungstechnischer Hinsicht ist zu betonen, dass die körperlichen, innerpsychischen und interpersonellen Veränderungen seit der Pubertät eine tief unbewusste Bedrohung der basalen Introjekte mit sich bringen, die in letzter Konsequenz für die Kontaktschwierigkeiten zu den Gleichaltrigen, Phänomene von Rückzug, Nihilismus, Depressivität und Verfolgungsängste verantwortlich sind.
7.2 Das schwierige Verhältnis des analytischen Psychotherapeuten zur Spätadoleszenz
Im Vorwort habe ich meinen Eindruck formuliert, dass es bei Psychotherapeuten Vorbehalte gibt, jungen Erwachsenen Behandlungsplätze anzubieten. Ich kann die Richtigkeit dieser These nicht objektivieren. Es gibt aber nicht wenige Kollegen, die diese Vorbehalte in persönlichen Gesprächen durchaus offen einräumen. Eine schlüssige Begründung für diese Haltung vermag ich nicht zu formulieren. Die Motive mögen auch unterschiedlich oder mehrdimensional sein. Einige Vermutungen zu dieser Einschätzung möchte ich aber versuchen.
Ein relevanter Aspekt ist womöglich darin zu suchen, dass die Adoleszenz in der theoretischen Auseinandersetzung innerhalb der Psychoanalyse erst spät ein spezifisches und systematisches Interesse mobilisiert hat. Diese Einschätzung korrespondiert mit der Annahme, dass der kontinuierlichen Arbeit an adoleszenten Themen in Selbsterfahrung und Lehranalyse bislang immer noch wenig Beachtung geschenkt wird. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass die (Spät-)Adoleszenz immanenter Begleiter der psychoanalytischen Bewegung war und ist. Früh in der psychoanalytischen Bewegung auftretende „Generationengegensätze“ konnten nicht bewältigt werden, sondern führten zu Abspaltungsbewegungen. Bis heute scheinen die psychoanalytischen Fachgesellschaften und auch die einzelnen Institute im Kampf zwischen den Vertretern einer „reinen Lehre“ und den Abweichlern gelähmt. Einflussreiche Ämter sind meist an ein fortgeschrittenes Alter gebunden.
Die Spätadoleszenz mit ihrem innewohnenden „revolutionären“ Potenzial hat es nicht nur in der Theorie der Psychoanalyse schwer, auch ihre Institutionen beginnen erst in den letzten Jahren, das kreative Potenzial der nachfolgenden Generation wahrzunehmen.
Die Geschichte der Anna O. ist in der psychoanalytischen Literatur aus vielfältigster Perspektive diskutiert worden. Sie dokumentiert als Geburtsstunde der Psychoanalyse gleichzeitig auch eine gescheiterte therapeutische Begegnung zwischen einer jungen Erwachsenen und ihrem Therapeuten, der aus der Elterngeneration stammt.
Im Rahmen der psychoanalytischen Ausbildung ist die Begegnung zwischen einem jüngeren und einem älteren Erwachsenen in Form der Lehranalyse institutionalisiert und anerkanntes Kernstück der Ausbildung. Aus der Perspektive der analytischen Beziehung scheint die Auflösung kindlicher Übertragungsanteile innerhalb der Lehranalyse mitunter recht gut zu gelingen. Dies ist sowohl hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit als Psychoanalytiker als auch in Bezug auf die regelmäßigen Begegnungen zwischen Lehranalytiker und Lehranalysand nach Beendigung der Ausbildungsanalyse am Institut von eminenter Wichtigkeit. Ein anderes Schicksal nimmt häufig der spätadoleszente (und damit real rivalisierende) Anteil dieser besonderen Beziehung und erscheint deutlich seltener eine systematische Durcharbeitung erfahren zu haben. Daraus folgt die Gefahr, dass die eigene Adoleszenz fremd bleibt, nicht wieder angeeignet werden konnte. Am eindrücklichsten werden die Folgen dieses Scheiterns am Miteinander der Generationen in den psychoanalytischen Instituten erkennbar. Das revolutionär-innovative Potenzial der nachfolgenden Generation kann, auch aufgrund des immanenten Angriffs, daher häufig kaum anerkannt werden.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree