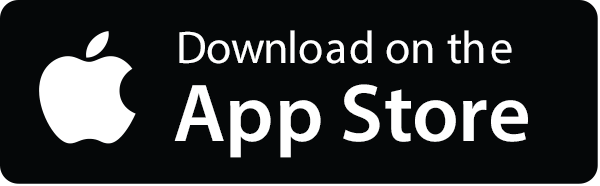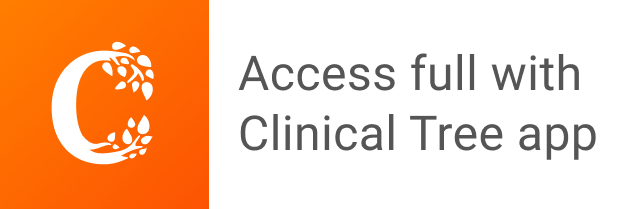Zusammenfassung
Hinsichtlich des therapeutischen Vorgehens wird vonseiten der analytischen Jugendlichenpsychotherapeuten, wohl ausgehend von Anna Freuds (1960) Forderung nach dem „Aufbau einer neuen Technik“, ein verändertes therapeutisches Vorgehen propagiert. Dieses Vorgehen betont eine aktivere Haltung des Therapeuten, eine Behandlung im Gegenübersitzen aufgrund der Ich-Schwäche des Adoleszenten, einen vorsichtigen Umgang mit Übertragungsdeutungen und die Rolle der Eltern im therapeutischen Prozess.
„Geniale Naturen […] erleben eine wiederholte Pubertät, während andere Leute nur einmal jung sind.“
Johann Peter Eckermann
Hinsichtlich des therapeutischen Vorgehens wird vonseiten der analytischen Jugendlichenpsychotherapeuten, wohl ausgehend von Anna Freuds (1960) Forderung nach dem „Aufbau einer neuen Technik“, ein verändertes therapeutisches Vorgehen propagiert. Dieses Vorgehen betont eine aktivere Haltung des Therapeuten, eine Behandlung im Gegenübersitzen aufgrund der Ich-Schwäche des Adoleszenten, einen vorsichtigen Umgang mit Übertragungsdeutungen und die Rolle der Eltern im therapeutischen Prozess.
In Bezug auf behandlungstechnische Überlegungen ergeben sich zwei grundlegende Fragen:
1.
Ist es notwendig, spezifische therapeutische Strategien einzusetzen?
2.
Wird eine besondere therapeutische Haltung benötigt?
Diese Fragen sollen und müssen diskutiert werden. Dazu möchte ich festhalten, dass die erste Frage aus meiner Sicht eine Vielzahl von Aspekten berührt. Die zweite Frage ist jedoch mit einem unmissverständlichen Ja zu beantworten.
Dass für die Behandlung von Patienten, bei denen eine Identitätsunsicherheit einen maßgeblichen Anteil an der Gesamtproblematik hat, eine Stabilität in der eigenen Identität aufseiten des Therapeuten eine wesentliche Voraussetzung darstellt, bedarf vermutlich keiner weiteren Begründung. Dennoch verdient dieser Aspekt Beachtung, da es vor dem Hintergrund einer (scheinbaren) Verwischung der Grenzen zwischen den therapeutischen Schulrichtungen bis hin zur Forderung nach einer „allgemeinen Psychotherapie“ (Grawe 1995), die sich an empirisch gefundenen Wirkfaktoren als Grundlage des therapeutischen Vorgehens orientiert, schwieriger geworden ist, zu einer eigenen und erarbeiteten therapeutischen Identität vorzudringen.
Fragen zur Behandlungstechnik werden innerhalb der psychoanalytischen Community üblicherweise entlang der jeweiligen theoretischen Orientierung diskutiert. Konkurrierend dazu hat sich eine eher störungsspezifische Betrachtungsweise mit Wurzeln in der Verhaltenstherapie und akademischen Psychotherapieforschung entwickelt, die ihr psychotherapeutisches Vorgehen aus der diagnostizierten Störung ableitet. Auch das Spannungsfeld dieser Traditionen erschwert möglicherweise die theoretische und persönliche Orientierung des psychotherapeutischen Nachwuchses in einem ausgesprochen komplexen Tätigkeitsfeld.
Ich hoffe, dass es mir bis hierher gelungen ist, zu verdeutlichen, dass die psychotherapeutische Arbeit mit Spätadoleszenten und jungen Erwachsenen den Behandler oder ein Behandlerteam mit einigen Besonderheiten konfrontiert, die durch die im vorhergehenden Absatz benannten behandlungstechnischen Zugangsweisen nicht hinreichend ausgeleuchtet werden.
Zunächst erinnert die Begegnung mit Patienten im jungen Erwachsenenalter kontinuierlich an das eigene Lebensalter bzw. das eigene Älterwerden. Gleichzeitig konfrontiert sie aber auch mit der eigenen Spätadoleszenz, den eigenen Strategien, dem eigenen Gelingen und Scheitern bei der Bewältigung der entsprechenden Entwicklungsaufgaben, auch mit eigenen ungelebten Träumen und ungenutzten Lebenschancen. Die Intensität von Fühlen und Denken, das Ringen um Entwicklung und Entscheidungen dieser Patienten schafft Faszination und Verbundenheit. Die Tatsache, mit Menschen therapeutisch zu arbeiten, die vieles noch vor sich haben, was im eigenen Leben der Vergangenheit angehört, sorgt aber auch unausweichlich dafür, dass Neid ein allgegenwärtiger Begleiter des therapeutischen Prozesses ist, dessen Leugnung aufseiten des Therapeuten fatale Folgen haben wird. Denn das zentrale Behandlungsziel, dem Patienten aus seiner erstarrten Entwicklung herauszuhelfen, kann erheblich gefährdet werden, wenn entweder keine ausreichende Distanz zum Patienten eingehalten wird oder die Leugnung des Neides zu einer vereinnahmenden, verführerischen oder besserwisserischen Haltung dem Patienten gegenüber beiträgt.
Bohleber (1981) macht darauf aufmerksam, dass die therapeutische Arbeit mit Menschen in dieser Lebensphase unausweichlich mit der eigenen Jugend und den eigenen Bewältigungs- und Lösungsstrategien, aber auch nicht gelebten Wünschen und Vorstellungen konfrontiert. Daraus resultiert die Möglichkeit wertender Überzeugungen. Nach Einschätzung Bohlebers stabilisiert der Wunsch bzw. die (vor- oder unbewusste) Haltung, dass die heutige Jugend die gleichen oder zumindest ähnliche Lösungen wählen mögen, den eigenen Verzicht. Andererseits kann die Identifikation mit den Jugendlichen, die andere Wege beschreiten und andere Strategien erproben, zu einer romantisierenden Einstellung führen.
Eine der Hauptgefahren (gestörter oder anfälliger) spätadoleszenter Entwicklungen liegt sicherlich in der Bedrohung durch den regressiven Sog, dem Festhalten an der heimlichen Hoffnung, sich den Mühen, der notwendigen inneren Arbeit und den Erfordernissen des Entwicklungsprozesses doch entziehen zu können. Auch aus dieser Feststellung ergeben sich nachhaltige Konsequenzen für die Gestaltung des therapeutischen Prozesses. Das regressive Element, das per se jedem therapeutischen Angebot innewohnt, stellt a priori eine Bedrohung für das labile Gleichgewicht des behandlungsbedürftigen Spätadoleszenten bzw. jungen Erwachsenen dar. Mühsam erworbene Autonomieschritte und fragile Identifizierungen zu deuten, ist immer von der Gefahr eines anwachsenden Widerstands oder aber eines intuitiven Rückzugs begleitet.
Nicht wenige spätadoleszente Patienten verwenden ihre psychische Energie nicht darauf, durch Explorations-, Integrations-, Eliminations- und Entscheidungsprozesse zu einer endgültigen Stabilisierung des Selbst und damit der eigenen psychischen Integrität beizutragen, sondern vielmehr dazu, genau diese Festlegungen zu vermeiden. Das von außen unverkennbare Bemühen, alle Möglichkeiten offenzuhalten, Festlegungen zu vermeiden, erfordert mit zunehmendem Alter die immer aufwendigere Leugnung einiger Aspekte der inneren und äußeren Realität, was zu einer Erstarrung der inneren und äußeren Entwicklung führen kann. Besonders wenn eine solche innere Organisation mit erheblichen Ressourcen bei dem Patienten einhergeht, kann es ausgesprochen schwierig und sogar quälend werden, als Therapeut zum Zeugen einer solchen verweigernden Entwicklung zu werden.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree