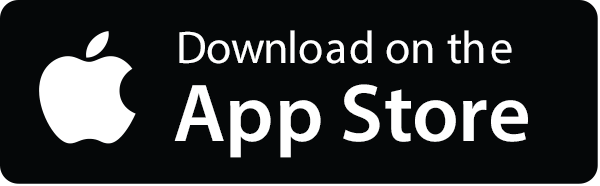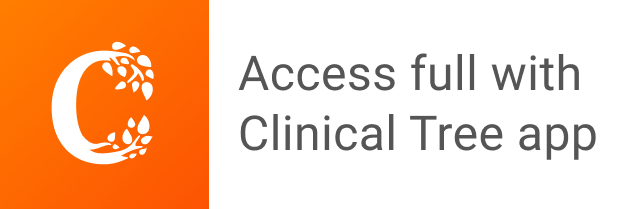Holger SalgeAnalytische Psychotherapie zwischen 18 und 252013Besonderheiten in der Behandlung von Spätadoleszenten10.1007/978-3-642-35357-4_2© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
2. Ein kurzer Abriss der psychoanalytischen Adoleszenztheorien
(1)
Fachklinik f. analytische Pschotherapie, Sonnenberg Klinik, Christian-Belser-Str. 79, 70597 Stuttgart, Deutschland
2.1 Sigmund Freud
2.3 Anna Freud
2.4 August Aichhorn
2.5 Erik H. Erikson
2.6 Peter Blos
2.10 Mario Erdheim
Zusammenfassung
Obwohl schon die ersten Fallgeschichten der Psychoanalyse in den Studien zur Hysterie die Begegnungen mit sehr jungen Patientinnen zum Gegenstand haben, hat Freud selbst dieser Lebensphase für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung keine besonders herausragende Bedeutung beigemessen, sie zumindest nicht explizit theoretisiert. Allerdings finden sich über sein Werk verstreut doch verschiedene Hinweise, die nicht nur die psychosexuelle Entwicklung im Blick haben, sondern auch die Bedeutung dieser Lebensphase für die soziale Entwicklung des Individuums hervorheben: „Die Ablösung des Kindes von den Eltern wird […] zu einer unentrinnbaren Aufgabe, wenn die soziale Tüchtigkeit des jungen Individuums nicht gefährdet werden soll“ (S. Freud 1909, S. 51). In seiner letzten großen Arbeit Das Unbehagen in der Kultur (S. Freud 1930, S. 462) schreibt er: „Die Familie will aber das Individuum nicht freigeben. Je inniger der Zusammenhalt der Familienmitglieder ist, desto mehr sind sie oft geneigt, sich von den anderen abzuschließen, desto schwieriger wird ihnen der Eintritt in den größeren Lebenskreis […] Die Ablösung von der Familie wird für jeden Jugendlichen zur Aufgabe, bei deren Lösung ihn die Gesellschaft oft durch Pubertäts- und Aufnahmeriten unterstützt.“
„Da hatte ich mich selbst, ganz für mich allein, und niemand beobachtete mich und niemand hemmte meine Schritte, ich konnte mit meinem Tag machen, was ich wollte, und das war das Unmögliche, mit mir selbst fertig zu werden, mir selbst ein Dasein zu verschaffen.“
Peter Weiss
2.1 Sigmund Freud
Obwohl schon die ersten Fallgeschichten der Psychoanalyse in den Studien zur Hysterie die Begegnungen mit sehr jungen Patientinnen zum Gegenstand haben, hat Freud selbst dieser Lebensphase für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung keine besonders herausragende Bedeutung beigemessen, sie zumindest nicht explizit theoretisiert. Allerdings finden sich über sein Werk verstreut doch verschiedene Hinweise, die nicht nur die psychosexuelle Entwicklung im Blick haben, sondern auch die Bedeutung dieser Lebensphase für die soziale Entwicklung des Individuums hervorheben: „Die Ablösung des Kindes von den Eltern wird […] zu einer unentrinnbaren Aufgabe, wenn die soziale Tüchtigkeit des jungen Individuums nicht gefährdet werden soll“ (S. Freud 1909, S. 51). In seiner letzten großen Arbeit Das Unbehagen in der Kultur (S. Freud 1930, S. 462) schreibt er: „Die Familie will aber das Individuum nicht freigeben. Je inniger der Zusammenhalt der Familienmitglieder ist, desto mehr sind sie oft geneigt, sich von den anderen abzuschließen, desto schwieriger wird ihnen der Eintritt in den größeren Lebenskreis […] Die Ablösung von der Familie wird für jeden Jugendlichen zur Aufgabe, bei deren Lösung ihn die Gesellschaft oft durch Pubertäts- und Aufnahmeriten unterstützt.“
Im Sinne seines „zweizeitigen Ansatzes der Sexualentwicklung beim Menschen“ galt ihm die Pubertät in erster Linie als Neuauflage der ödipalen Problematik. Freud verzichtet damit explizit auf eine Differenzierung zwischen der Pubertät als einem biologischen Vorgang und der Adoleszenz als einem überwiegend soziokulturellen Phänomen. Im 3. Kapitel der Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, das mit „Die Umgestaltungen der Pubertät“ überschrieben ist, skizziert Freud die zu leistenden Entwicklungsschritte: die Unterordnung der erogenen Zonen unter das Primat des Genitales, unterschiedliche Sexualziele der Geschlechter und die Wahl von Sexualobjekten außerhalb der eigenen Familie (S. Freud 1905). Jones vertiefte diese Perspektive einige Jahre später zu der sogenannten Rekapitulationstheorie der Adoleszenz (Jones 1922). Die Entwicklung der ersten fünf Lebensjahre wird aus dieser Perspektive auf einem höheren seelischen Niveau erneut durchlaufen, führt aber nicht zu einer inneren Neuorganisation.
Hervorzuheben ist allerdings die Bedeutung, die Freud der adoleszenten Ablösungsthematik für die Kulturentwicklung zusprach. In den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (S. Freud 1905, S. 128) heißt es: „Gleichzeitig mit der Überwindung und Verwerfung dieser deutlich inzestuösen Phantasien wird eine der bedeutsamsten, aber auch schmerzhaftesten, psychischen Leistungen der Pubertätszeit vollzogen, die Ablösung von der Autorität der Eltern, durch welche erst der für den Kulturfortschritt so wichtige Gegensatz der neuen Generation zur alten geschaffen wird.“
Diese Betrachtungsweise, deren Berechtigung sich in den mehr als 100 Jahren seit ihrer Formulierung in der gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder in beeindruckender Weise bestätigt hat, fand über Jahrzehnte hinweg allerdings nur wenig Beachtung innerhalb und außerhalb der analytischen Community. Nachdem auch die Überlegungen von Siegfried Bernfeld in den 1920er-Jahren zur „gestreckten Pubertät“ in ihrer Beziehung zur Jugendbewegung letztlich wenig Resonanz fanden, war es Mario Erdheim vorbehalten, den Zusammenhang zwischen Adoleszenz und Kulturentwicklung wieder aufzugreifen und auch theoretisch systematisch weiterzuentwickeln.
Erst kürzlich wies T. Aichhorn (2012) auf die Thematisierung der Pubertät in einer frühen Arbeit Freuds –Entwurf einer Psychologie (S. Freud 1950) – hin. Im 2. Kapitel dieser Arbeit, 1895 verfasst, aber 1950 erstmalig und 1987 in korrigierter und vollständiger Form veröffentlicht, werden die Aspekte des zweizeitigen Ansatzes des Sexuallebens und das Phänomen der Nachträglichkeit erstmalig formuliert. Auch der Einfluss von affektivem Erleben auf andere Bereiche des Seelenlebens, besonders auf das Denken, wird in dieser Darstellung berührt: „Es ist eine ganz alltägliche Erfahrung, dass Affektentwicklung den normalen Denkablauf hemmt, und zwar in verschiedener Weise“ (S. Freud 1950, S. 449). In dieser Lesart beschäftigt sich bereits eine der ersten psychoanalytischen Arbeiten Freuds mit der Pubertät und ihren nachhaltigen Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums.
2.2 Siegfried Bernfeld
Als Beitrag zur Theoriebildung nicht nur von pathologisch verlaufenden Pubertäts- und Adoleszenzphänomenen, sondern auch der normalen Entwicklung sind die Überlegungen von Bernfeld aufzufassen. Dieser „unermüdliche Pubertätsforscher“ (A. Freud 1960) interessierte sich bei seinen Beobachtungen für die vielfältigen Erscheinungsformen jugendlicher Entwicklung auch jenseits der Sexualentwicklung. Bernfeld konzeptionalisierte sie als ein ausgesprochen vielgestaltiges Phänomen und beschäftigte sich mit der Wirkung des Spannungsverhältnisses zwischen inneren und äußeren Einflüssen auf die Persönlichkeit. Zudem untersuchte er die sozialen Aspekte dieser Altersphase, insbesondere die Rolle der Gleichaltrigen. In seiner einflussreichsten Arbeit fokussierte er die Bedeutung der Sublimierung im Zusammenhang mit den Phänomen der „verlängerten“ Pubertät bei einem bestimmten Typus männlicher Heranwachsender und beschrieb deren Neigung zu künstlerischer Aktivität und Hinwendung, zu idealistischen Lebenshaltungen und geistigen Idealen als Ausdruck der stagnierenden Entwicklung (Bernfeld 1923). Bernfeld verbreiterte mit seinem Beitrag, der durch breite klinische Erfahrungen gestützt war, die Theoretisierung der Adoleszenz über triebtheoretische Aspekte hinaus.
2.3 Anna Freud
Eine weitere Kontexterweiterung der ursprünglichen Betrachtungsweise erfolgte ab den 1930er-Jahren durch Anna Freud. Sie kam zu der Einschätzung, dass die Pubertät als spezifische Entwicklungsstufe von der psychoanalytischen Theoriebildung vernachlässigt worden sei. Anna Freud stellte zunächst die in dieser Lebensphase notwendigen Leistungen des Ich und besondere Formen der Bewältigung im Sinne spezifischer Abwehrmechanismen wie Askese, Intellektualisierung und primitive Formen der Identifizierung in den Fokus ihrer Überlegungen (A. Freud 1936). Dabei verzichtete sie aber, ebenso wie zunächst auch Bernfeld, auf die Unterscheidung zwischen der Pubertät als biologischem Entwicklungsvorgang und der Adoleszenz als des psychischen Entwicklungsprozesses infolge der körperlichen Veränderungen.
Später erweiterte sie ihre Perspektive und betrachtete den durch die Pubertät eingeleiteten Lebensabschnitt als eine Phase des Aufruhrs und der notwendigen Disharmonie: „ […] zu jeder anderen Lebenszeit würden innere Widersprüche dieser Art Symptome eines krankhaften Zustandes sein. In der Adoleszenz haben sie eine andere Bedeutung. Sie sind nicht mehr als ein Hinweis darauf, dass das Ich nach Lösungen sucht, sie aufnimmt und wieder verwirft und zögert, endgültige Entscheidungen zu treffen“ (A. Freud 1960, S. 22). Schließlich betont Anna Freud noch stärker die Entwicklungsmöglichkeiten, die dieser Lebensphase innewohnen und die von Eissler bald darauf als die „zweite Chance“ (Eissler 1966), die die Pubertät dem Menschen gewährt, konzeptionalisiert wird. Insofern beschreibt Anna Freud „die schweren Konflikte, die sich zwischen Ich und Es abspielen nicht als Krankheitserscheinungen, […] sondern als Heilungsvorgänge, d. h. als Versuche, den verlorenen Frieden und die Harmonie von neuem herzustellen“ (A. Freud 1958, S. 1768). Konsequenterweise betont sie: „1. dass die Pubertät ihrem Wesen nach die Unterbrechung einer Periode friedlichen Wachstums bedeuten muss; und 2. dass das Weiterbestehen von innerem Gleichgewicht und Harmonie während der Pubertät eine abnorme, nicht normale Erscheinung ist“ (A. Freud 1960, S. 21). Als Ziel dieser mitunter sehr turbulent in Erscheinung tretenden inneren und äußeren Kämpfe sieht Anna Freud den Abzug der libidinösen Besetzungen von den Eltern und deren Verlagerung auf nichtinzestuöse Liebesobjekte. Dieser Prozess muss notwendigerweise mit einer Entidealisierung der Eltern einhergehen.
Anna Freud verweist aber auch auf den großen Wert für Therapeuten, den die Begegnung mit adoleszenten Entwicklungen für diesen mit sich bringe. „Wie immer der Ausgang ist, für den Analytiker bleibt es bedeutsam, dass keine andere Lebensperiode ihm ähnliche Einsichten in das innere Kräftespiel von Gefahr, Angst, Abwehrtätigkeit und Symptombildung verschaffen kann“ (A. Freud 1960, S. 4).
Die Verbindung von adoleszenten Entwicklungsschwierigkeiten und den präödipalen Beziehungserfahrungen, von spezifischen adoleszenten Ängsten und der Vehemenz der benötigten Abwehrmaßnahmen und auch deren Auswirkung auf die Entwicklung spezifischer Ich-Funktionen weckte das besondere Interesse von Anna Freud. Die Darstellung der erheblichen behandlungstechnischen Schwierigkeiten junger Patienten verweist auf die weitreichenden klinischen Erfahrungen als Grundlage der formulierten theoretischen Konzeptionen.
2.4 August Aichhorn
Der Beitrag August Aichhorns zur Theoriebildung gründete in der pädagogischen Arbeit mit jungen Delinquenten (Aichhorn 1925). Er interessierte sich für die Entwicklung von fehlenden Anpassungsmöglichkeiten, Dissozialität, Kriminalität und Verwahrlosung besonders bei männlichen Jugendlichen. Seine theoretischen Überlegungen zur Über-Ich-Entwicklung bei diesen Menschen haben sehr zum Verständnis dissozialer junger Erwachsener beigetragen. Allerdings wurden die Arbeiten Aichhorns eher im Bereich der Pädagogik als innerhalb der Psychotherapie und Psychoanalyse rezipiert. August Aichhorn gilt als Begründer einer psychoanalytischen Pädagogik.
2.5 Erik H. Erikson
Einen wesentlichen Impuls, durchaus über die Theoriebildung innerhalb der Psychoanalyse hinaus, gaben die Arbeiten von Erik H. Erikson. Er erweiterte die vorliegenden libidotheoretischen und Ich-psychologischen Perspektiven konsequent um eine soziale Dimension und führte den Begriff der Ich-Identität in die Diskussion ein: „Vorläufig können wir zusammenfassend sagen: Identität, die am Ende der Kindheit zum bedeutendsten Gegengewicht gegen die potenziell schädliche Vorherrschaft des kindlichen Über-Ichs wird, erlaubt dem Individuum sich von der übermäßigen Selbstverurteilung, dem diffusen Hass auf Andersartiges zu befreien. Diese Freiheit ist eine der Voraussetzungen dafür, dass das Ich die reife Sexualität, die neuen Körperkräfte und die Aufgaben eines Erwachsenen zu integrieren vermag“ (Erikson 1966, S. 212). Insbesondere die Interpretation der Adoleszenz als einer von der Gesellschaft gewährten psychosozialen Aufschubphase im Sinne eines „psychosozialen Moratoriums “ war für die Weiterentwicklung der Diskussion von großer Bedeutung. Als Moratorium beschreibt er einen Raum, „durch welchen die Gesellschaften und Untergesellschaften der Jugend eine Zwischenwelt zwischen Kindheit und Erwachsenenalter gewähren: ein psychosoziales Moratorium, in dessen Rahmen die Extreme subjektiven Erlebens, die Alternativen ideologischer Ausrichtung und die Möglichkeiten realistischer Verpflichtung erst spielend und dann in gemeinschaftlicher Bemeisterung erprobt werden können“ (Erikson 1966, S. 212). Auf die Störanfälligkeit der in diesem Zwischenraum stattfindenden Prozesse macht Erikson aufmerksam, wenn er darauf hinweist, dass in den westlichen Gesellschaften auch Formen der Jugendkriminalität und des „Patiententums“ als Versuche von Heranwachsenden zu interpretieren sind, sich solch ein Moratorium zu verschaffen. In seiner Betrachtungsweise ist es nicht mehr die Bewältigung aus der Triebwelt stammender Impulse, die den Motor der Entwicklung darstellt, sondern die Auseinandersetzung des Adoleszenten mit seiner gesellschaftlichen Umgebung ermöglicht und fordert Entwicklung.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree