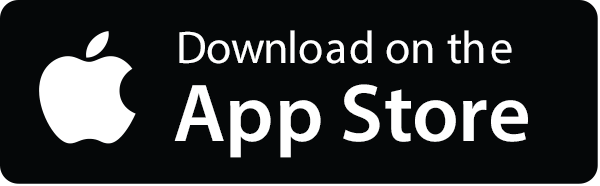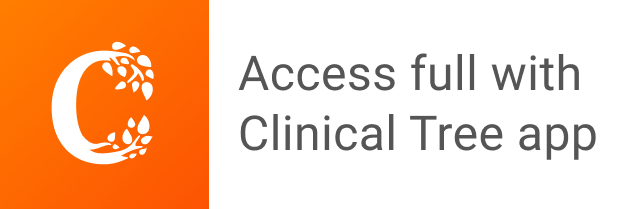Abb. 9.1
Gruppenskulptur. (Mit freundlicher Genehmigung von Heinz Kurz)
Schon in der Auswahl des Objekts, seiner Beschaffenheit und der Geschwindigkeit der Entscheidung in der ersten Sitzung gibt sich häufig ein Teil der Problematik des Patienten zu erkennen. Die Konsequenzen der in diesem Moment getroffenen Entscheidung und der Bezugnahme zu diesem einen Objekt, das den Patienten nun für die Dauer seines Aufenthalts begleiten wird, gibt sich erst im Therapieverlauf, besonders beim Auftreten von Krisen, zu erkennen. Insofern werden sich die Motive für die Wahl gerade dieses Objekts erst während des Aufenthalts erschließen, wenn überhaupt.
Die hohe körperliche Beanspruchung und Anstrengung, das Erleben des eigenen Arbeitsrhythmus und den der anderen, die Schlaggeräusche der Hämmer, die Konzentration auf das Werkzeug und dessen Nutzung sowie die Berührung der Steinoberfläche beim Darüberstreichen bewirken ein „Sichselbstspüren“. Dem Berühren des Materials kommt nach Knöbel (2008, S. 17) häufig aber auch noch eine weitere Bedeutung zu: „Es hat eine besondere Qualität, wie ein ‚Streicheln‘ und zeigt häufig auch den Wunsch nach Körperkontakt und Berührung – nach berühren und berührt werden.“ Diese Form der Gestaltungstherapie spricht aber nicht nur den Tastsinn an, sondern erschließt verschiedene „Phänomene der Wahrnehmung und der Kommunikation“ (Kurz 1997). Neben dem Tasten wird das Sehen, Hören und Riechen, aber auch der Bewegungssinn, der Gleichgewichtssinn und der Gestaltungswille angesprochen.
Zum Ende des Aufenthalts entsteht immer die Frage nach dem Verbleib des Steins. Mit dieser Frage und ihrer Beantwortung verbinden sich vielfältige Aspekte. Das Erleben des Gestaltungsprozesses und des gesamten Therapieverlaufs, die Einstellung und Verbindung zum geschaffenen Objekt selbst, Gefühle von Enttäuschung, Erleichterung und Stolz, aber auch die erwarteten Reaktionen aus dem Umfeld werden wirksam. Für manche Patienten steht es außer Frage, dass sie ihr Objekt mit zu sich nach Hause nehmen. Andere hatten von Beginn an die Idee, ihr fertiggestelltes Objekt zu verschenken. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, die Skulptur an einem selbst gewählten Ort auf dem Gelände der Klinik zu deponieren oder auf den „Steinfriedhof“ zu tragen.
Diesem Schritt geht allerdings der Abschied voraus. Die Arbeit am Stein innerhalb dieser Gruppe, an diesem Ort kommt unwiederbringlich zu einem Ende. Da Patienten dieser Altersgruppe in der Regel große Schwierigkeiten mit Trennungen haben, diese gerne leugnen oder bagatellisieren, ist eine 45-minütige Phase der letzten Gruppensitzung dezidiert dem Rückblick des Patienten auf seinen Gestaltungs- und Therapieprozess gewidmet. Dabei wird deutlich, dass zwar eine Skulptur entstanden ist, dennoch Offenes, Unfertiges und Ungeklärtes verbleibt. Der Abschied ist kein einseitiger. Nicht nur der scheidende Patient, sondern auch die zurückbleibenden Gruppenmitglieder und der Therapeut müssen sich mit der Situation auseinandersetzen.
Der Patient erhält zum Abschied eine CD mit wöchentlich angefertigten Fotos, auf der die Entwicklung seiner Skulptur festgehalten ist. Am Tag der Entlassung laden der Therapeut und der Patient das Objekt gemeinsam auf einen Sackkarren und bringen es entweder zum Auto des Patienten oder zu seinem Bestimmungsort auf dem Klinikgelände.
Fallvignette
Eine recht schizoid organisierte junge Frau will ihren „Stein“ nach Beendigung der Behandlung zunächst als Leihgabe in der Klinik lassen. Sie hat in mehrmonatiger Arbeit einen Kopf mit einem Verzweiflung und Grauen gleichermaßen vermittelndes Gesicht gestaltet und reagiert ausgesprochen überrascht, aber auch sehr berührt, als wir ihrer Idee zustimmen, dieses Objekt im Eingangsbereich vor der Klinik aufzustellen. Dreieinhalb Jahre später nimmt sie wieder Kontakt zum Gestaltungstherapeuten auf, um mitzuteilen, dass sie nun ihren Stein abholen wolle.
Die Methode des dreidimensionalen Gestaltens ist bei den jungen Patienten, zumindest in den ersten Behandlungswochen, in der Regel wenig beliebt. Die Konfrontation mit der intensiven, sinnlichen Erfahrung des gemeinsamen Arbeitens, dem hohen Geräuschpegel im Atelier, der Notwendigkeit körperlicher Anstrengung, der relativen Enge im Raum, der Kleinschrittigkeit des Vorankommens sowie der Erfahrung der Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit mobilisiert selbstverständlich erhebliche Frustrationserfahrungen und lässt für viele Patienten das Therapieangebot zunächst nur als Zumutung erscheinen. Insbesondere Patienten, deren Bewältigungsstrategie in besonderer Weise durch Ausweichen und Vermeidung gekennzeichnet ist, versuchen immer wieder, sich dem Therapieangebot durch Verschlafen, Vergessen, ausgedehnte Pausen oder offene Verweigerung zu entziehen. Durch die Arbeit in der Gruppe, Konfrontationen durch die Mitpatienten und den Gestaltungstherapeuten lässt sich diese Haltung in der Regel aber nicht über die ganze Therapiedauer aufrechterhalten, sodass sich letztlich fast alle Patienten auf eine Auseinandersetzung mit dem selbst gewählten Objekt im dreidimensionalen Gestalten einlassen (müssen).
Die Arbeit am Stein konfrontiert auf unmittelbare Weise in jedem Moment des Tuns mit der Thematik der Trennung und der damit verbundenen Veränderung. Das ursprüngliche Objekt wird durch die eigene Aktivität verändert und bekommt somit auch eine Geschichte. Nicht wenige Patienten versuchen, dieser Konfrontation dadurch zu entgehen, dass sie dem vorhandenen Objekt gegenüber eine ausweichende Haltung einnehmen („So wie der Stein ist, ist er schön, da braucht man nichts mehr zu verändern“), um so ihr Bedürfnis, das Vorhandene zu bewahren, ganz eindeutig zum Ausdruck zu bringen.
9.3.4 Die Körper- und Bewegungstherapie
Die Körpertherapie findet in einer adaptiven Form der konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) statt. Dabei nutzt der Körper- und Bewegungstherapeut sehr verschiedene methodische Zugänge, etwa spielerische Begegnungen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik, Bogenschießen und Naturerfahrungen, die aufgrund der landschaftlichen Einbettung der Klinik sehr gut möglich sind.
Die Körpertherapie findet im Rahmen des stationären Therapiesettings zweimal wöchentlich mit 90-minütigen Therapieeinheiten statt. Die Teilnahme an der Körper- und Bewegungstherapie ist, wie an allen anderen Therapieteilen des Settings, verbindlich. Im Gegensatz zum dreidimensionalen Gestalten, bei dem der Therapeut, parallel zu seiner wahrnehmenden Haltung dem Geschehen in der Gruppe gegenüber, während der Gestaltungsphase ebenfalls an seinem Objekt arbeitet, behält der Therapeut während der Körpertherapie eine beobachtend-begleitende Position inne.
Aufgrund der schon mehrfach benannten Schwierigkeiten Spätadoleszenter und junger Erwachsener in Bezug zum eigenen (sexuellen) Körper wie auch in der körperlichen Begegnung mit dem bedeutsamen Anderen kommt der Körper- und Bewegungstherapie eine besondere Bedeutung zu. Dabei sollte die Gestaltung eines wirksamen körpertherapeutischen Angebots den zugrunde liegenden Ängsten der Patienten, ihrer Neigung zum passiven Ausweichen, der ebenfalls vorhandenen (heimlichen) Neugier und Erwartung und der immer vorhandenen Scham Rechnung tragen. Gleichzeitig wird der Körpertherapeut im Umgang mit seiner Methode immer berücksichtigen, dass Körpertherapie vielleicht mehr als andere therapeutische Zugangsweisen in der Lage ist, Abwehr zu unterlaufen.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree