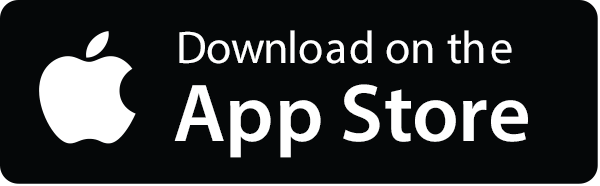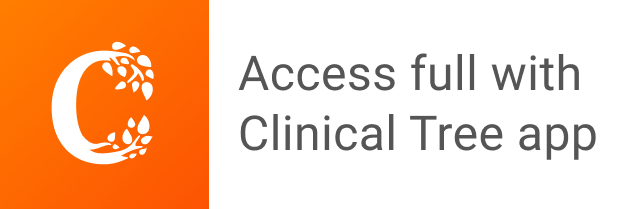Aber nicht nur die Grenzen zwischen klinischer Praxis und Forschung sind sehr durchlässig, sondern auch diejenigen zwischen sogenannter angewandter Forschung und Grundlagenforschung.
Klinische Forschung
Von verschiedenen Definitionsversuchen ([5], [6]) sei der für Deutschland wichtige der DFG genannt: die DFG hat 2000 in ihrer Denkschrift „Klinische Forschung“ einen weiteren Begriff von klinischer Forschung vertreten, ihn aber gleichwohl „als integrierende Bezeichnung für die methodisch unterschiedlichen, jedoch in der Zielsetzung konvergenten Ansätze der grundlagenorientierten, der krankheitsorientierten und der patientenorientierten Forschung verwendet.“ [3]
So hat sich auch die psychiatrische Forschung zu den Grundlagen psychischer Krankheiten und ihrer Behandlung aus der Klinik entwickelt:
Emil Kraepelin (1856–1926), einer der Begründer der wissenschaftlich fundierten Psychiatrie, hat nicht nur die mittels „Zählkarten“ dokumentierte systematische Beobachtung der Verläufe psychischer Krankheiten zur Grundlage seines nosologischen Konzepts gemacht, sondern Spezialisten an seine Klinik gezogen, die mit eigenen neuromorphologischen Methoden nach den Ursachen, Entstehungs- und Verlaufsbedingungen psychischer Krankheiten suchten. Mit der Verfeinerung und wachsenden Komplexität dieser Methoden setzte eine methodenorientierte Institutionalisierung ein, die Kraepelin in München zur – heute würde man wohl Outsourcing sagen – Gründung der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie neben der Klinik führte. Kraepelin wollte klinische Fragestellungen der Psychiatrie mit den damals zur Verfügung stehenden Forschungsmethoden der Neuropathologie, der Erblichkeitsforschung und der experimentellen Psychologie beantworten. Die 1912 von ihm initiierte und 1917 mit der mäzenatischen Spende des amerikanischen Bankiers James Loeb gegründete Forschungsanstalt wurde 1924 an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angegliedert, 1954 in deren Nachfolgeorganisation, die Max-Planck-Gesellschaft als Max-Planck-Institut für Psychiatrie (Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie ) übernommen und in ein hirnpathologisches Institut mit den zusätzlichen Forschungsgebieten Serologie und Mikrobiologie sowie ein klinisches Institut mit den zusätzlichen Forschungsgebieten Genealogie, Demographie und Biochemie gegliedert, 1962 entsprechend der Eigendynamik der mit rein naturwissenschaftlichen Methoden arbeitenden und damit von der Klinik wegdriftenden weiteren Forschungsgebiete Neurochemie, Neuropharmakologie, Neurophysiologie in ein klinisches und ein theoretisches Teilinstitut gegliedert. Aus Letzterem entstand 1998 das ausschließlich grundlagenwissenschaftlich arbeitende MPI für Neurobiologie, während Ersteres als MPI für Psychiatrie weiterhin Grundlagenforschung, klinische Forschung und Patientenversorgung im Bereich der Psychiatrie verbindet. Erreicht wird diese interdisziplinäre und patientenorientierte Forschungsarbeit durch Arbeitsgruppen, in denen neben Psychiatern und Psychologen Forscher aller naturwissenschaftlichen Disziplinen gemeinsam an der Ursachenklärung und möglichen Therapieentwicklung psychiatrischer Erkrankungen arbeiten [10]. Die Entwicklung zeigt, dass in der Klinik gebildete Forschungsgruppen methodenimmanent zur Institutionalisierung neigen und damit von der Klinik wegstreben: „brain drain “ von der patientennahen klinischen Forschung zur patientenfernen Grundlagenforschung.
Noch klinikferner arbeitete das von Oskar Vogt (1870–1959) gegründete Hirnforschungsinstitut in Berlin-Buch. Vogt richtete neben seiner nervenärztlichen Berliner Praxis ein tierexperimentelles Labor ein und entwickelte daraus ein 1902 der Universität angegliedertes neurobiologisches Labor. Sein Plan für ein differenziert disziplinär gegliedertes Hirnforschungsinstitut wurde 1914 von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft aufgegriffen und 1931 mit Mitteln der Krupp-Familie (aus Dank für die erfolgreiche psychotherapeutische Behandlung von Bertha Krupp von Bohlen und Halbach [17], S. 49–51, zit. [18], S. 79) in Buch realisiert (heute Max-Delbrück-Zentrum für Molekulare Medizin MDC ). Dieses damals modernste Hirnforschungsinstitut wurde weltweit Vorbild für weitere Hirnforschungsinstitute, so in Moskau und Washington/Bethesda. Vogt baute das Institut in Berlin-Buch in unmittelbarer Nähe der III. Städtischen Irrenanstalt, um den Patientenbezug seiner Forschung herzustellen [1]. Es betrieb morphologische, biochemische und neurophysiologische Hirnforschung zu den Ursachen psychischer (und neurologischer) Krankheiten. Vogt und seine Frau Cécile (1876–1962) entwickelten aus der feinarchitektonischen Analyse der in Schichten und Areale gegliederten Hirnrinde von verstorbenen psychisch Kranken die Lehre, dass die Nervenzellen bestimmter Hirnareale besonders vulnerabel gegenüber äußeren Einflüssen seien und zu jeweils speziellen Krankheiten disponieren (Pathoklise ). Diese Befunde der Grundlagenforschung i. e. S. haben aber bisher noch nicht zu klinisch brauchbaren Ergebnissen geführt. Jedoch kann man diesen Gedanken auch in aktuellen Ansätzen zur Wechselwirkung zwischen molekulargenetisch definierter Disposition und peristatischer Belastung sehen.
Zwischen der hirnmorphologischen Analyse als einem Exponenten der Grundlagenforschung und der Translationsforschung als einem Exponenten angewandter Forschung spannt sich das weite Feld von Forschungsaktivitäten in der Psychiatrie, die mehr oder weniger krankheitsbezogen – wie im erstgenannten Fall – oder patientenbezogen – wie im letztgenannten Fall – sind. Es erscheint müßig, hier nach Abgrenzungen zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung zu suchen, denn entscheidend ist allemal die an Klarheit der Fragestellung, Angemessenheit und Stringenz der Methode und überzeugender Analyse der Befunde orientierte Qualität der Forschungsuntersuchung. Will man dennoch aus wissenschaftspolitischen Gründen abgrenzen, dann könnten als Abgrenzungskriterien zwischen beiden Forschungsformen genannt werden:
Forschungsfragen zu Ursachen und Bedingungskonstellationen psychischer Krankheiten, vor allem solche, die nur tierexperimentell oder nur mit Hilfe von Wissenschaftlern aus nichtpsychiatrischen Disziplinen (z. B. Neurochemiker, Physiologen, Genetiker, Informatiker, Epidemiologen, Neuropsychologen, Soziologen, Philosophen) bearbeitet werden können, gelten eher als Grundlagenforschung , während Forschungsfragen zur Diagnostik oder Behandlung von psychischen Krankheiten, die der Mitarbeit von Patienten bedürfen, eher der angewandten Forschung subsumiert werden könnten.
Bei Forschung mit Patienten wiederum dürfte eine ätiopathogenetische Forschung eher der Grundlagenforschung zuzurechnen sein, therapeutische bzw. evidenzbasierte Forschung hingegen eher der angewandten Forschung.
Entsprechend könnte das für die Nutzen-Risiko-Abschätzung ethisch relevante Kriterium von Forschung ohne oder mit direktem potenziellem Nutzen für den an der Forschung teilnehmenden Patienten als Abgrenzungskriterium genutzt werden.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree