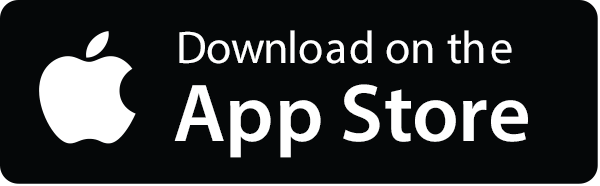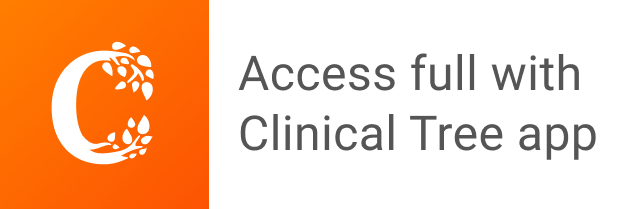Aufgabe
Scheitern
Akzeptanz des eigenen (sexuellen) Körpers
Essstörungen, Dysmorphophobie, gestörte Sexualität, selbstverletzendes Verhalten
Fähigkeit zu Intimität und Partnerschaft
Leugnung des Bedürfnisses nach Partnerschaft oder promiskuitiver Umgang mit dem eigenen Körper
Neue tragfähige Beziehungen zu Gleichaltrigen
Sozialer Rückzug, Idealisierung des Anderssein, Idealisierung von Einsamkeit, Festhalten am Rückzug in kompensierende Tagtraumwelten oder virtuelle Welten
Ökonomische Unabhängigkeit
Festhalten an kindlichen Versorgungsansprüchen,Verzicht auf regelmäßige Erwerbstätigkeit, Ich-syntone Haltung gegenüber Ansprüchen zum Lebensunterhalt durch Dritte (Eltern, staatliche Institutionen)
Entwicklung und Verfolgung eines eigenen Lebensentwurfs
Entwicklung bzw. Stabilisierung eines falschen Selbst, Einfrieren der persönlichen Entwicklung mit Verweigerung der Übernahme von Verantwortung
Anerkennung der Tatsache des „Aufsichgestelltseins“
(Unbewusstes) Festhalten am Phantasma der mangelnden inneren Ausstattung, der eigenen Unfertigkeit
Verzicht auf bzw. Integration von Omnipotenz- und Grandiositätsvorstellungen
(Heimliches) Beharren auf narzisstischen Lebensentwürfen, Leugnung der Notwendigkeit von Arbeit und Anstrengung
Entwicklung eines reifen Ich-Ideals
Erleben der Unerträglichkeit der Lücke zwischen Ich-Ideal und Real-Selbst mit der drohenden Etablierung von Vermeidung und Ausweichen als Lebensprinzip
Entwicklung einer stabilen persönlichen Identität
Identitätsdiffusion, gestörte Identitätsentwicklung, drohende Fragmentierung, Entwicklung eines falschen Selbst
Bereitschaft und Fähigkeit zu sozialer Verantwortung und politischem Handeln
Verlagerung eigener Verantwortung und eigener Ziele in eine unbestimmte Zukunft
Erleben von Trauer und Abschied und die Anerkennung von verstreichender Lebenszeit als einer Lebenstatsache
Manifestation regressiver Lebensarrangements in Verbindung mit der Notwendigkeit des „Einfrierens“ der eigenen Entwicklung
Modulation und Stabilisierung einer eigenen Moralität
Dissoziale Entwicklung
Die Verortung dieser Aufgaben in der Spätadoleszenz bedeutet selbstverständlich keine ausschließliche normative Zuordnung in die entsprechende Lebensphase, hilft aber doch aus therapeutischer Perspektive bei der Gewichtung von Phänomen, Symptomen und Auffälligkeiten. Eine eigenverantwortliche Orientierung in der Welt hat die wesentliche Bewältigung dieser Aufgaben zur Voraussetzung. Diese Einschätzung behält im Kern vermutlich auch in einer beschleunigten, globalisierten Welt ihre Gültigkeit.
Dennoch ergibt sich natürlich die interessante, vermutlich sogar weitreichende Frage, inwieweit die aktuellen Anforderungen, die sich aus einer beschleunigten und globalisierten Welt ergeben, sich auf die Persönlichkeitsentwicklungen der aktuellen und zukünftigen Generationen auswirken werden. Die Folgen, die aus der unverkennbaren Verlängerung des vielfach benannten psychosozialen Moratoriums für junge Erwachsene, aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt erwachsen, bleiben momentan noch schwer abzuschätzen.
Besonders augenfällig zeigt sich diese Konstellation am veränderten Studierverhalten der aktuellen Studentengeneration. Vonseiten der Studienordnungen mit einer Zunahme von Reglementierungen konfrontiert, reagiert ein Großteil der Studenten mit einer starken Ziel- und Karriereorientierung. Dies betrifft insbesondere Studiengänge mit einer stringenten beruflichen Ausrichtung. Nebeninteressen und die Option breit angelegter Zugänge zu Bildungsmöglichkeiten weichen eindimensionalen Ausbildungen. Dadurch wird auch hier die Frage aufgeworfen, welche individuellen und auch gesellschaftlichen Auswirkungen aus diesem konsequenten Verzicht auf persönliche und vordergründig zweckfreie Entwicklungsräume erwachsen. Im Hinblick auf S. Freuds These eines notwendigen Gegensatzes zwischen den Generationen als Motor der kulturellen Entwicklung,stimmt die Beobachtung solch forcierter Anpassungsprozesse ganzer Studentenjahrgänge an vermutete oder tatsächliche Realitäten nachdenklich.
Auch in der „normalen“ Entwicklung Spätadoleszenter und junger Erwachsener lässt sich das Nebeneinander von (Über-)Anpassung , Verweigerung und Vermeidung beobachten. Anpassungsphänomene wären demzufolge in Form einer unkritischen und eindimensionalen Erfüllung der Anforderungen in Schule, Ausbildung und Studium, als Reaktion auf die Betonung der hohen Bedeutung von Wissen, Kompetenz und Qualifikation in der aktuellen Bildungslandschaft auszumachen. Verweigerung und Vermeidung ließe sich dann eher hinsichtlich der fehlenden Übernahme von Verantwortung im persönlichen Bereich mit Rückzug von jeder Form eines gesellschaftlich-politischem Engagements und letztlich auch fehlender Generativität feststellen.
4.3 Identitätsentwicklung
Das Konzept der Identität gehörte nie zu den zentralen Theoremen der Psychoanalyse, da es nicht mühelos mit der psychoanalytischen Strukturtheorie zu vereinbaren war. Dennoch bleibt dieses theoretische Konstrukt aus dem Grenzbereich von Psychologie, Psychoanalyse, Soziologie und Philosophie für die Auseinandersetzung mit jungen Menschen in verschiedenen Entwicklungsphasen unverzichtbar. Begriffe wie Identität, Identitätsgefühl, Identitätsdiffusion und Identitätsstörung spielen für die Konzeptionalisierung der Abgrenzung von Gesundheit und Krankheit in dieser Lebensphase eine besondere Rolle. Erst in der Adoleszenz konsolidiert sich die Fähigkeit, eine exzentrische Position gegenüber dem eigenen Denken und Handeln einzunehmen. Die kontinuierliche Arbeit am eigenen Identitätsentwurf ist eine der zentralen Herausforderungen dieses biografischen Abschnitts.
Ohne der ideengeschichtlichen Entwicklung des Identitätsbegriffs nachgehen zu wollen, bleibt festzuhalten, dass Identität das Produkt der Vermittlung zwischen Innen und Außen ist, der Vermittlung zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen an den Einzelnen und seiner psychischen Einzigartigkeit, seiner inneren Wirklichkeit. Die Entwicklung und das Erleben von Identität sind nicht möglich, ohne auf sich selbst durch die Augen der Anderen zu schauen, aber auch selbst den Anderen zum Objekt der eigenen Beobachtung werden zu lassen (Salge 2009). Die Auseinandersetzung mit der (eigenen) Identität ist insofern auch immer eine Beschäftigung mit dem Nichtidentischen, dem Fremden. Psychoanalytische Konzepte sind an dieser Stelle von besonderer Bedeutung, da das Unbewusste immer auch einen Bezug zu den abgelehnten, geleugneten oder anderweitig abgewehrten und damit nicht bewusstseinsfähigen Anteilen des eigenen Selbst hat, die in der Regel als nicht identisch erlebt werden. In dieser Perspektive von Identität als einer ständigen Vermittlung von subjektiver Welt und äußerer Realität einerseits sowie bewussten und unbewussten Dimensionen der Persönlichkeit andererseits wird sowohl der letztlich immer konflikthafte und gleichzeitig nie statische oder gar abgeschlossene Charakter von Identitätsentwicklung evident. Die Komplexität dieses theoretischen Konstrukts wird zusätzlich deutlich, wenn die verschiedenen Dimensionen von Identität und deren Zusammenwirken in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Zentrale Aspekte wie Geschlechtsidentität und ethnische Identität prägen das Selbsterleben ebenso wie familiäre, soziale und berufliche Zugehörigkeit. Gerahmt werden diese durch ein Erleben von Stabilität der psychischen Repräsentanz, der eigenen Persönlichkeit über die Zeit.
Die immer wieder in verschiedensten Facetten aufgeworfenen Fragen des (Spät-)Adoleszenten „Wer bin ich?“ und „Wer möchte ich einmal sein?“ lassen sich nur durch ein lebendiges und ständiges Oszillieren zwischen Introspektion, Fantasieren als Antizipationsversuch, Probehandeln und Offenheit für die Perspektive des bedeutsamen Anderen auf das eigene Selbst beantworten. Die authentische Begegnung mit diesen Fragen bedeutet aber auch ein echtes Risiko, da deren Beantwortung mit eigenen Defiziten und der Anerkennung der Angewiesenheit auf den Anderen konfrontiert. Insofern gibt sich an dieser Stelle auch die enge Verbindung der Identitätsentwicklung mit dem Affekt der Scham, insbesondere in dessen entwicklungsfördernder Funktion, zu erkennen.
„Die Ablösung des Kindes von den Eltern wird […] zu einer unentrinnbaren Aufgabe, wenn die soziale Tüchtigkeit des jungen Individuums nicht gefährdet werden soll“ (S. Freud 1909, S. 51). Schon in diesem Zitat Sigmund Freuds wird die enge Verbindung zwischen innerer und äußerer Entwicklung bei der Identitätsentwicklung deutlich. Intensivere Beachtung erfuhr diese Lebensphase durch Anna Freud, die einerseits die Bewältigung des Lebensabschnitts in seiner Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung herausarbeitete und gleichzeitig den besonderen Stellenwert spezifischer Abwehrmechanismen, besonders der Askese und Intellektualisierung , benannte.
Einen wesentlichen Beitrag zur Theorie der Identität und deren Bedeutung für die Adoleszenz und den Übergang ins Erwachsenenalter hat Erik H. Erikson geleistet. Er führte den Begriff der Ich-Identität ein und wollte damit einen Zuwachs an Persönlichkeitsreife verstanden wissen, „den das Individuum am Ende der Adoleszenz der Fülle seiner Kindheitserfahrungen entnommen haben muss, um für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüstet zu sein“ (Erikson 1966, S. 123). Erikson verweist ebenfalls auf die beiden Richtungen, in die Identitätsentwicklung zielt bzw. aus denen sie gespeist wird: „Der Begriff Identität drückt also insofern eine wechselseitige Beziehung aus, als er sowohl ein dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilhaben an bestimmten gruppenspezifischen Charakterzügen umfasst“ (Erikson 1966, S. 124).
In diesem Zusammenhang erscheint die Feststellung notwendig, dass die zitierten theoretischen Überlegungen zur Identität und Identitätsentwicklung sich am Identitätskonzept der Moderne orientieren. Trotz der entstandenen Beschleunigung von Veränderungsprozessen seit Beginn der industriellen Revolution dominierte bislang ein Wandlungstempo, welches den Mitgliedern jeder Generation noch die Möglichkeit eröffnete, eine eigenen Position in der Welt zu finden, zu behaupten und zu verteidigen. Im Kontext dieser Arbeit entsteht dabei die Frage, welche Auswirkungen für die Identitätsentwicklung bzw. deren Störungen die Beschleunigungsvorgänge der Spätmoderne haben. Aus diesen veränderten Bedingungen der Identitätsbildung ergeben sich möglicherweise weitreichende Konsequenzen für die Ziele psychotherapeutischer Behandlungen, da sich aktuelle psychotherapeutische Behandlungskonzepte zumindest implizit auf die Vorstellungen zur Identitätsentwicklung und Identitätsstabilität der Moderne beziehen.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree