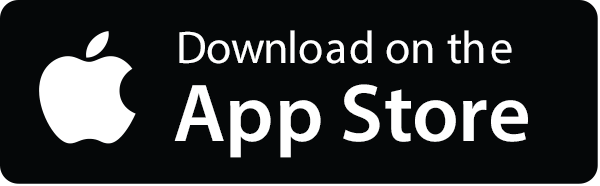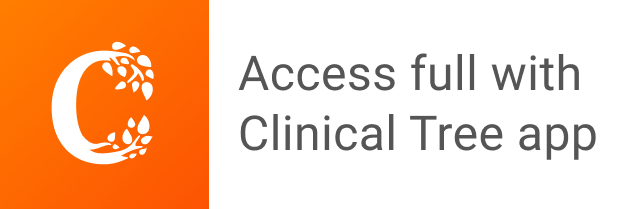Patientenwohl
Kriterium erfüllt für die in Stellungnahmen spezifizierten Indikationen
Besondere Aufklärung über Risiken (kognitive Nebenwirkungen) und Rückfallrisiko notwendig
Selbstbestimmung
Einwilligungsfähigkeit sollte individuell geprüft werden
Bei sorgfältiger (schriftlicher) Aufklärung ist das Kriterium erfüllt
Bei nichteinwilligungsfähigen Patienten sind gesetzliche Vorschriften zu beachten
Gerechtigkeit
Verfügbarkeit nicht erfüllt (keine flächendeckende Versorgung, Stigmatisierung)
Bei nichteinwilligungsfähigen Patienten treten die Gesetze des jeweiligen Landes in Kraft, z. B. in Deutschland das Betreuungsverfahren. Das Prinzip der Gerechtigkeit beinhaltet auch, dass nichteinwilligungsfähige Patienten Zugang zu optimaler Behandlung erhalten, dass nach sorgfältiger Risiko-Nutzen-Abwägung mit bspw. Zustimmung des gesetzlichen Betreuers die EKT durchgeführt werden kann. In den USA werden ca. 1 bis 2 % der EKT Behandlungen mit richterlicher Zustimmung durchgeführt [36], [55]. Widerspricht der nichteinwilligungsfähige Patient der EKT ausdrücklich, muss zunächst davon Abstand genommen werden, es sei denn es handelt sich um eine lebensbedrohliche Situation.
10.3 Transkranielle Magnetstimulation (TMS )
10.3.1 Methode
Die transkranielle Magnetstimulation basiert auf dem physikalischen Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Es handelt sich um ein nichtinvasives Verfahren zur Modulation der Funktion umschriebener kortikaler Areale. Eine an den Schädel angelegte Magnetspule wird kurzzeitig (100–250 μs) von einem Starkstromimpuls (bis 3.000 A) durchflossen, was zum Aufbau eines Magnetfeldes (bis zu 2 Tesla) führt. Dieses führt zur Veränderung der Aktivität von Neuronen und führt letztendlich zu Muskelkontraktionen in der Peripherie. Unterschieden wird die Stimulation mit einzelnen Magnetfeldpulsen von der Stimulation mit Impuls-Salven, der sogenannten repetitiven Magnetstimulation (rTMS). Weiterhin unterschieden werden die niedrig- und die hochfrequente Stimulation. Die repetitive Stimulation wird gleichermaßen in der Forschung und in der klinischen Anwendung eingesetzt. Eine neue Stimulationsform ist die tiefe TMS (deep TMS, dTMS) . Dabei können mit einer speziellen Spule (H coil) tiefer gelegene Hirnareale stimuliert werden. Die klinische Behandlung mittels rTMS und dTMS erfolgt in der Regel in täglichen Sitzungen von jeweils etwa 30 Minuten über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen.
10.3.2 Anwendung in der Psychiatrie
Die mittelgradige Depression ist die häufigste klinische Indikation für die transkranielle Magnetstimulation [24]. Andere psychiatrische Indikationen die zurzeit erforscht werden sind: akustische Halluzinationen, Negativsymptome der Schizophrenie, Manie und Zwangserkrankung, Tourette-Syndrom, posttraumatische Belastungsstörung und Panikstörung sowie ADHS und Autismus [10]. Eine breite Anwendung findet die TMS in Forschung und Diagnostik z. B. zur Erforschung des Maßes für die kortikale Erregbarkeit, zur Untersuchung von Medikamenteneffekten, des emotionalen Zustands, der Plastizität von Lernprozessen, des Schlafs und der Rekonvaleszenz nach einem Hirninfarkt. Es existieren Empfehlungen und Leitlinien zur Anwendung [50], [56].
Absolute Kontraindikationen für die Anwendung der TMS sind magnetisierbare Metallteile im Schädel (z. B. Kochleaimplantate, Hirnstimulatoren), eine erhöhte Anfallsneigung oder erhöhter intrakranieller Druck. Relative Kontraindikationen sind die Einnahme von Medikamenten, die die Anfallsneigung erhöhen, Schlafentzug und Erkrankung des Herzens [56].
Bis heute ist der exakte Wirkmechanismus nicht bis in alle Details bekannt. Ein Problem ist die Wahl des Stimulationsortes und die präzise Wiederfindung desselben, wobei der beste Ort zur Behandlung der Depression noch nicht gefunden ist [44]. Die klinische Wirksamkeit variiert je nach psychiatrischer Erkrankung, Stimulationsort und -parameter. Aufgrund einer großen klinischen Studie mit Stimulation über dem präfrontalen Kortex [50] wurde 2008 die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) von der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für die mittelgradige Depression zugelassen. Zusätzlich besteht eine Klasse-I-Evidenz bei mittelgradiger therapieresistenter Depression entweder als alleinige Therapie oder als „add-on“ in Kombination mit Medikamenten. Die Anwendung der TMS bei anderen psychiatrischen Störungen als der Depression wird aktuell hinsichtlich des klinischen Nutzens kontrovers diskutiert. Noch nicht geklärt ist zudem, welche Spulenlokalisation zur Stimulation am Schädel die beste ist und welche Behandlungsparameter die effektivsten sind [29], [56].
10.3.3 Nebenwirkungen
Die TMS gilt als sichere Methode. Nebenwirkungen treten in Abhängigkeit der verwendeten Methode (TMS, rTMS) und der Stimulationsparameter auf [56]. Die häufigsten Nebenwirkungen sind vorübergehende Kopfschmerzen oder lokale Schmerzen und Parästhesien. Am meisten gefürchtet ist das Auslösen eines Krampanfalls (weniger als 0,5 %). Kognitive Funktionen werden nicht beeinflusst, sodass die Patienten ambulant behandelt werden können. Sehr selten treten vorübergehende Veränderungen der Hörfähigkeit, Synkopen oder manische Zustände auf [56]. Änderungen der Persönlichkeit sind bislang nicht berichtet worden.
10.3.4 Ethisch relevante Fragestellungen der TMS
Patientenwohl
Der aktuelle Forschungsstand und die klinischen Erfahrungen lassen die TMS als nichtinvasives Verfahren mit geringem Nebenwirkungsrisiko erscheinen. Auf der anderen Seite ist der klinische Nutzen umstritten und allenfalls für die Behandlung der therapierefraktären mittelgradigen Depression nachgewiesen. Depressive Patienten, denen konventionelle Behandlungsverfahren (Psychotherapie und Pharmakotherapie) nicht hinreichend helfen konnten, haben eine Aussicht auf klinische Verbesserung bei geringem Risiko. Es wäre dann gemeinsam mit dem Patienten zu überlegen, ob eine andere Behandlung, deren klinischer Nutzen besser bekannt ist, z. B. EKT, Vagusnervstimulation, vorzuziehen ist bis Einigung z. B. über den besten Stimulationsort und die optimalen Stimulationsparameter herrscht. Für andere psychiatrische Erkrankungen ist die klinische Wirkung noch nicht hinreichend belegt, sodass hier potenzielle Nebenwirkungen und individuelle Risiken stärker in die Risiko-Abschätzung eingehen müssen und auch alternative Behandlungsoptionen überlegt werden sollten.
Selbstbestimmung
Bei der Indikation therapieresistente Depression sollte der Patient über Alternativbehandlungen aufgeklärt werden. Die Anwendung bei anderen psychiatrischen Indikationen sollte nur nach ausführlicher Aufklärung im Rahmen von Studien erfolgen. Hier muss besonders auf den experimentellen Charakter der Intervention hingewiesen werden.
Gerechtigkeit
Da die TMS nur in wenigen Kliniken verfügbar ist, haben nicht alle Patienten die gleiche Möglichkeit, diese Behandlung zu erhalten. Daher entfällt für einige Patienten mit mittelschweren therapieresistenten Depressionen die Option auf ein antidepressiv wirksames Verfahren mit geringem Nebenwirkungsrisiko. Dieses Problem tritt bei vielen Therapieverfahren auf, deren Wirksamkeitsnachweis noch aussteht. In der Regel kommt ein Patient in eine Klinik, welche Standardbehandlungen anbietet und darüber hinaus maximal ein zur Erprobung befindliches Verfahren. Außerdem werden auch nicht alle zugelassenen Verfahren in jeder Klinik angeboten. Greifen die Standardtherapien nicht, hat der Patient die Möglichkeit, maximal ein in der Erprobung befindliches Verfahren im Rahmen von Studien auszuprobieren. Nur wenige Kliniken können dem Patienten die Wahl zwischen mehreren nichtzugelassenen Verfahren überlassen, zumal die jeweiligen Studieneinschlusskriterien die Teilnahme vieler Patienten zusätzlich beschränken.
Tab. 10.2
Ethische Prinzipien für die Anwendung der transkraniellen Magnetstimulation bei psychiatrischen Indikationen
Ethisches Prinzip | Anforderung an klinische Studien |
|---|---|
Patientenwohl | Wirksamkeit nur bei therapieresistenter Depression mittleren Schweregrades nachgewiesen, geringes Nebenwirkungsrisiko |
Weitere klinische Studien notwendig zur Festlegung des optimalen Stimulationsortes und der optimalen -parameter | |
Abwägung alternativer Behandlungsverfahren der Depressionsbehandlung (VNS, EKT) | |
Andere psychiatrische Indikation nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien mit klaren wissenschaftlichen Hypothesen und individueller Risiko-Nutzen-Abwägung | |
Selbstbestimmung (Einwilligungsfähigkeit) | Sorgfältige Aufklärung über experimentellen Charakter des Verfahrens, wenn außerhalb der Zulassung angewendet |
Aufklärung über alternative Behandlungsoptionen | |
Gerechtigkeit (Verfügbarkeit) | Nur an bestimmten Kliniken, häufig nur im Rahmen von klinischen Studien verfügbar |
10.4 Magnetkrampftherapie (MKT )
10.4.1 Methode
Die Magnetkrampftherapie ist eine Weiterentwicklung aus der transkraniellen Magnetsimulation. Es werden sekundär generalisierte Krampfanfälle mittels starker Magnetfelder (ca. 4 Tesla) ausgelöst. Dies erfolgt in Kurzzeitnarkose und unter Muskelrelaxation [57]. Der Ablauf der MKT-Behandlung entspricht im Wesentlichen der EKT. Im Mittel werden 8 bis 12 Behandlungen pro Patient in einer Behandlungsserie durchgeführt. Es wird vermutet, dass die Auslösung des Krampfanfalles fokussierter ist und so weniger kognitive Nebenwirkungen als bei der EKT auftreten [59].
10.4.2 Anwendung in der Psychiatrie
Die MKT wird zurzeit nur in wenigen Zentren durchgeführt, da es weltweit nur einzelne Stimulationsgeräte gibt. Zudem wird diese zurzeit nur in klinischen Studien bei Patienten mit therapieresistenten uni- und bipolaren Depressionen angewendet. Ausschlusskriterien sind Metallteile im Kopf sowie ein erhöhtes Narkoserisiko. Erste Hinweise auf eine vergleichbare signifikante antidepressive Wirkung wie bei der EKT sind publiziert [32], [33]. In der Bonner Arbeitsgruppe wurden bis heute ca. 30 depressive Patienten mit MKT behandelt. Weiterführende Studien mit größeren Patientensamples sind zwingend notwendig, um dieses vielversprechende Hirnstimulationsverfahren weiterentwickeln zu können und die klinische Wirksamkeit abschließend beurteilen zu können.
Im Folgenden soll beispielhaft die Risiko-Nutzen-Bewertung aus einem unserer bewilligten Anträge an die Ethikkommission zitiert werden:
Die Patienten, die in diese Studie eingeschlossen werden, erfüllen die Indikation für eine Elektrokrampftherapie. Aus heutiger Sicht bedingt ein Behandlungsversuch mit Magnetkrampftherapie kein höheres Nebenwirkungsrisiko als eine Elektrokrampftherapie. Erste Ergebnisse lassen darauf schließen, dass das Nebenwirkungspotenzial von Magnetkrampftherapie eher milder ist, vor allem im kognitiven Bereich. Aufgrund von theoretischen Überlegungen und ersten Ergebnissen hat die Magnetkrampftherapie mit hoher Wahrscheinlichkeit einen klinisch relevanten antidepressiven Effekt. Falls die Magnetkrampftherapie eine ähnliche antidepressive Wirksamkeit wie Elektrokrampftherapie hat, wäre dies eine substanzielle Verbesserung des krampfinduzierenden antidepressiven Behandlungskonzeptes. Alle Patienten werden während der Magnetkrampftherapie medikamentös antidepressiv weiter behandelt. Nach der 6. Magnetkrampftherapie-Sitzung wird anhand der Werte auf der Hamilton-Depressionsskala entschieden, ob die Magnetkrampftherapie-Behandlung weitergeführt oder ob auf Elektrokrampftherapie umgestellt werden soll. Patienten, die nicht mindestens eine 30-prozentige Verminderung auf der Hamilton-Depressionsskala zeigen, werden mit bilateraler Elektrokrampftherapie weiterbehandelt. Insgesamt erscheint das Nutzen-Risiken-Verhältnis als günstig.
10.4.3 Nebenwirkungen
10.4.4 Ethisch relevante Fragestellungen zur MKT
Patientenwohl und Selbstbestimmung
Das Patientenwohl wird dadurch geschützt, dass die MKT nur in klinischen Studien in Expertenzentren durchgeführt wird. Die Anwendung der Forschungsstandards (Patienteninformation, zustimmendes Votum der Ethikkommission, schriftliche Einwilligungserklärung etc.) schützt ebenfalls das Patientenwohl. Als Behandlungsalternative steht den Patienten die EKT mit potenziell stärkeren kognitiven Nebenwirkungen zur Verfügung.
Gerechtigkeit
Im Fall der MKT tritt das Problem der Verteilungsgerechtigkeit deutlicher zutage als bei der EKT. Die Anzahl der möglichen Studien wird durch das weltweite Existieren von nur wenigen Geräten limitiert. Trotz vorläufiger Ergebnisse, die eine hochsignifikante und gleiche antidepressive Wirksamkeit bei geringerem Nebenwirkungsprofil nahelegen, ist die Erforschung der MKT von der Planung der Herstellerfirma abhängig, d. h., klinische Studien können nur durchgeführt werden, wenn die Firma der Forschungsgruppe ein Gerät zur Verfügung stellt und die Studie durch Drittmittelgeber finanziert wird. Verliert eine Firma das Interesse an der Vermarkung des MKT-Gerätes (meist aus ökonomischen Erwägungen) haben die Universitäten kaum die Möglichkeit, diese Behandlungsmethode weiterzuentwickeln. Im Falle der MKT scheint es weltweit aus diesem Grund zu einem Forschungsstopp zu kommen und den Patienten geht eine potenziell antidepressiv wirksame Behandlung wie die EKT mit wahrscheinlich geringerem kognitiven Nebenwirkungsrisiko als die EKT verloren. Diese partielle Überlappung der Interessensbereiche von universitärer Forschung und von Sponsorenfirmen spricht gegen das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit und muss deshalb in forschungsethischen Überlegungen berücksichtigt werden. Konkret kann eine Herstellerfirma die Verfügbarkeit dieser Behandlung für Patienten bestimmen, indem die Firma einzelnen Forschergruppen MKT-Geräte zur Nutzung überlässt.
Tab. 10.3
Ethische Prinzipien für die Anwendung der Magnetkrampftherapie bei psychiatrischen Indikationen
Ethisches Prinzip | Anforderung an klinische Studien |
|---|---|
Patientenwohl | Erste Erfolg versprechende Pilotdaten bei Depressionen |
Durchführung nur im Rahmen von klinischen Studien | |
Abwägung alternativer Behandlungsverfahren (VNS, EKT) | |
Keine wissenschaftlichen Hypothesen zur Anwendung bei anderen Indikationen | |
Selbstbestimmung (Einwilligungsfähigkeit) | Sorgfältige Aufklärung über experimentellen Charakter des Verfahrens |
Aufklärung über alternative Behandlungsoptionen (VNS, EKT) | |
Gerechtigkeit (Verfügbarkeit) | Weltweit nur in wenigen Forschungszentren verfügbar |
Erforschung als Alternativbehandlung zu EKT mit gleicher klinischer Wirksamkeit und weniger kognitiven Nebenwirkungen notwendig | |
Kriterium nicht erfüllt, da weitere Forschung durch die Abhängigkeit von Sponsorenfirmen und dem Fehlen staatlicher Forschungsförderung behindert wird |
10.5 Vagusnervstimulation (VNS )
10.5.1 Methode
Bei der Vagusnervstimulation wird der linke 10. Hirnnerv, der sogenannte Vagusnerv, elektrisch gereizt. Die Implantation der Elektroden und des Pulsgenerators erfolgt unter Vollnarkose. Die Elektroden, die auf Höhe des Halses in wenigen Zentimetern Tiefe um den Nervus vagus geschlungen werden, sind durch ein Kabel mit einem elektrischen Pulsgenerator verbunden. Der Pulsgenerator „Schrittmacher“ wird unter der Haut im Brustbereich implantiert und kann transkutan programmiert werden.
Der Wirkmechanismus der VNS ist nicht im Detail bekannt. Der Vagusnerv hat im Halsbereich einen hohen Anteil von afferenten Fasern (etwa 80 %). Durch polysynaptische Verbindungen können über diese Nervenfasern vor allem via N. tractus solitarius verschiedene kortikale und subkortikale Areale beeinflusst werden, die bei der Affektregulation (u. a. der Depression) eine wichtige Rolle spielen [49]. Typische Stimulationsparameter sind eine Stromstärke von 0,25 mA, eine Frequenz von 20 bis 30 Hz, eine Pulsweite von 250 bis 500 µs. Die Stimulation erfolgt meist für 30 s alle 3 bis 5 min.
10.5.2 Anwendung in der Psychiatrie
Im Jahre 2005 wurde die VNS von der Food and Drug Administration zur Behandlung der therapieresistenten Depression zugelassen. In der Europäischen Union ist die VNS ebenfalls für diese Indikation als Add-on-Therapie zugelassen und wird von den Krankenkassen übernommen. Die 1-Jahresresponse der VNS in Kombination mit Medikamenten liegt bei ca. 50 % [19]. Weitere randomisierte placebokontrollierte Studien könnten die Wirksamkeit bei therapieresistenten Depressionen und spezifische Prädiktoren des Ansprechens näher untersuchen.
Gegenwärtig wird auch die Wirksamkeit des Vagusnervstimulators in der Behandlung anderer psychiatrischer Krankheitsbilder wie z. B. Angststörungen und Alzheimer Demenz untersucht.
Bei schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen, insbesondere dem AV-Block, sollte die VNS nicht angewandt werden, bei Schlafapnoe sollte die Implantation sehr gut bedacht werden [19].
10.5.3 Nebenwirkungen
Nebenwirkungen der Operation und der Behandlung sind meist nur leicht ausgeprägt. Schmerzen im Bereich der Narben sind die häufigsten Probleme, andere Komplikationen wie äußerliche Infektionen sind selten. Nebenwirkungen der Stimulation sind Heiserkeit, eine Veränderung der Stimme und Husten, die nur während der Zeit der Stimulation auftreten, im Verlauf aber an Intensität verlieren. Halsschmerzen und Parästhesien in Form eines Kribbelns im Halsbereich wurden ebenfalls berichtet [19], [62]. Langzeiterfassungen bei Epilepsiepatienten zeigen eine Reduktion sämtlicher unerwünschter Wirkungen auf ein Niveau von unter 3 % nach 3 Jahren. In den bisher durchgeführten Studien ergaben sich keine Hinweise auf schwerwiegende unerwünschte Ereignisse durch die VNS, sodass insgesamt von einer guten Verträglichkeit der Behandlungsmethode auszugehen ist. Ein weiteres Risiko ist die Narkose.
10.5.4 Ethisch relevante Fragestellungen zur VNS
Patientenwohl
Die Wirksamkeit der Vagusnervstimulation ist in internationalen Studien für die Behandlung therapieresistenter Depression nachgewiesen und daraufhin in den USA und Europa für diese Indikation zugelassen. Langjährige Erfahrung besteht ebenfalls in der Behandlung der Epilepsie, sodass Risiken, die durch die Behandlung entstehen (z. B. Nebenwirkungen wie langfristige Komplikationen des Schrittmachers, Batteriewechsel) abschätzbar sind. Im Vergleich zur TMS scheinen die Wirksamkeit größer, aber die Risiken ebenfalls höher zu sein (invasiver Eingriff, Vollnarkose). Insofern sollte im Einzelfall mit dem Patienten zusammen abgewogen werden, ob die VNS die geeignete (und bevorzugte) Therapieform ist.
Für andere psychiatrische Indikationen (Alzheimer, Angststörungen) steht der Nachweis der Wirksamkeit noch aus. Da es sich bei der Methode um einen invasiven Eingriff handelt, sollte die VNS bei anderen Indikationen nur nach sorgfältiger individueller Risikoabwägung erfolgen, ebenso sollte eine wissenschaftliche Hypothese über den Wirkmechanismus existieren und der Behandlungserfolg sowie Nebenwirkungen systematisch kontrolliert werden. Falls andere konventionelle Therapieverfahren noch nicht angewendet wurden, sollten diese erst durchgeführt werden, sodass nach aktuellem Forschungsstand ausschließlich therapieresistente psychiatrische Patienten für die VNS in Frage kommen. Bei der Risiko-Nutzen-Abwägung sollte auch beachtet werden, dass andere Diagnostik (z. B. MRT) nicht mehr durchgeführt werden kann und die VNS eine Langzeitbehandlung ist, d. h. dass die Patienten u. U. lebenslang auf ein technisches Gerät angewiesen sind.
Für die Behandlung der therapieresistenten Depression erscheint also das Kriterium des Patientenwohles erfüllt zu sein. Es ist allerdings zu beachten, dass weitere Studien zur Wirksamkeit und zur Analyse von Prädiktoren (z. B. vorheriges Ansprechen auf EKT) für ein Ansprechen auf die VNS im Sinne des Patientenwohles anzustreben wären.
Selbstbestimmung
Zur Behandlung der therapieresistenten Depression ist nach schriftlicher Aufklärung und Einwilligung das Kriterium der Einwilligung erfüllt. Besondere Sorgfalt ist bei anderen psychiatrischen Indikationen in Studien notwendig. Es sollten alle wissenschaftlichen Standards der klinischen Forschung erfüllt sein (u. a. schriftliche Patienteninformation, Einwilligungserklärung, Abklärung alternativer konventioneller Behandlungsmöglichkeiten etc.).
Gerechtigkeit
Die Möglichkeit, eine VNS bei therapieresistenter Depression zu erhalten, ist durch das Vorhandensein weniger Zentren limitiert, in denen diese Therapieform mit psychiatrischer Begleitung angeboten wird. Die Tatsache, dass nur die Operation und nicht die unbedingt notwendigen und oft aufwendigen Nachbehandlungen von den Krankenkassen übernommen wird, lässt diese Behandlungsoption für die Klinik als wenig rentabel erscheinen, sodass sich die Verfügbarkeit wahrscheinlich in Zukunft nicht wesentlich verbessern wird.
Tab. 10.4
Ethische Prinzipien für die Anwendung der Vagusnervstimulation bei psychiatrischen Indikationen
Ethisches Prinzip | Anforderung an Anwendung und klinische Studien |
|---|---|
Patientenwohl | Zugelassen für therapieresistente Depression, Kriterium erfüllt |
Andere psychische Indikation nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien mit klaren wissenschaftlichen Hypothesen und individueller Kosten-Nutzen-Abwägung | |
Weitere randomisierte kontrollierte Studien zum Wirksamkeitsnachweis (Langzeitwirkung) bei Depression anzustreben, um Prädiktoren der Wirksamkeit zu finden und die Zielgruppe näher zu definieren | |
Abwägung weniger invasiver, etablierter Behandlungen (TMS) bei therapieresistenter Depression | |
Selbstbestimmung (Einwilligungsfähigkeit) | Sorgfältige Aufklärung über alternative Behandlungsoptionen (TMS, EKT) bei therapieresistenter Depression (TRD) |
Bei Anwendung in anderen Indikationen Aufklärung über experimentellen Charakter des Verfahrens | |
Gerechtigkeit (Verfügbarkeit) | Für TRD nur wenige Zentren, in denen VNS angeboten wird, da unzureichende Vergütung durch die Krankenkasse, Kriterium nicht erfüllt |
10.6 Tiefe Hirnstimulation (THS )
10.6.1 Methode
Die tiefe Hirnstimulation gilt als eine weiterentwickelte Alternative zur ablativen Neurochirurgie [63]. Seit Anfang der 1990er Jahre wird die THS mit großem Erfolg zur Behandlung verschiedener neurologischer Erkrankungen (Parkinson, essenzieller Tremor, Dystonie) eingesetzt.
Zwei dünne Elektroden (1,26 mm) werden in einer stereotaktischen Operation in genau definierte Areale des Gehirns, meist im wachen Zustand unter lokaler Schmerzbekämpfung, implantiert. Subkutan werden diese Elektroden dann mit einem Pulsgenerator unter Vollnarkose verbunden. Dieser kann transkutan programmiert werden. Im Unterschied zur VNS wird meist kontinuierlich stimuliert. Typische Stimulationsparameter sind Frequenzen von etwa 90 bis 130 Hz, Pulsbreiten von 90 ms und eine Spannung von 4 bis 6 Volt. Die Elektroden können wieder entfernt werden. Eine Hauptfrage in der derzeitigen Forschung ist das Zielgebiet, in das die Elektroden platziert werden. Der Wirkmechanismus der THS ist noch nicht hinreichend geklärt, wahrscheinlich wird die Funktion dysfunktionaler neuronaler Netzwerke moduliert.
10.6.2 Anwendung in der Psychiatrie
Bei psychiatrischen Erkrankungen wird die THS seit ca. 10 Jahren in klinischen Studien und Einzelfällen eingesetzt. Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit liegen für therapieresistente Zwangsstörungen und Depressionen vor. In den USA gibt es eine Ausnahmegenehmigung der Food and Drug Administration (FDA) für therapieresistente Zwangserkrankungen [14]. Die THS wird im Rahmen von klinischen Studien in Europa bei verschiedenen psychiatrischen Indikationen erforscht.
Zielgebiete im Gehirn bei Zwangserkrankungen sind der vordere Schenkel der inneren Kapsel [22], der Nucleus subthalamicus [46], der Nucleus caudatus und der Nucleus accumbens [23]. Durch die THS sollen dysfunktionale, hyperaktive dopaminerge und serotonerge neuronale Netzwerke moduliert werden. Im Mittel resultierte bei mindestens 50 % der Patienten eine klinisch signifikante Verbesserung der Zwangssymptome nach Behandlung mit THS.
Studien, die THS bei therapieresistenten Depressionen erforscht haben, konnten eine Symptomverbesserung um 50 bis 60 % der insgesamt weltweit ca. 100 behandelten Patienten nachweisen. Zielgebiete, die zurzeit erforscht werden, sind der subgenuale cinguläre Cortex ([27], [34], [45], [53]), das ventrale Striatum ([47], [48]), der Nucleus Accumbens ([5], [6]) und das mediale Vorderhirnbündel [7], [8], [64]. Erste Ergebnisse zur Behandlung therapieresistenter Depression bei bipolaren Erkrankungen lassen auf eine ähnliche klinische Wirksamkeit wie bei der therapieresistenten Depression schließen [27]. Neue, zurzeit debattierte Indikationen sind Abhängigkeitserkrankungen [37], Demenz [40], Angsterkrankungen (LIT), Essstörungen [31] und Schizophrenie [38].
10.6.3 Nebenwirkungen
Das größte Risiko während der Implantation der Elektroden in das Gehirn besteht in der Verletzung von Gefäßen. Intrazerebrale Blutungen (1–3 %), Krampfanfälle (1–5 %) und Infektionen, meist die Generatortasche betreffend, (2–25 %) sind weitere mögliche Nebenwirkungen. Eine Infektion des Gehirns oder ein Hirnabszess sind extrem seltene Ereignisse. Nebenwirkungen bei der Stimulation treten häufiger auf. Diese sind je nach Stimulationsort unterschiedlich und sind in den meisten Fällen durch eine Veränderung der Stimulationsparameter reversibel. Die Nebenwirkungen können Parästhesien (z. B. Wärmegefühl im Gesicht), Muskelkontraktionen, Dysarthrie, Diplopie, autonome Dysfunktion, Bewegungsstörungen, Zunahme von Angst und Hypomanie sein [6], [27], [45]. Negative Auswirkungen auf die Kognition sind bislang nicht beschrieben worden [25], [26], [34]. Einzelne Berichte von Persönlichkeitsveränderungen durch die THS bei neurologischen Patienten [66] sind in psychiatrischen Studien bisher noch nicht untersucht. Es besteht jedoch das Risiko, dass sich unabhängig von der Wirkung der THS nach Implantation Sinnkrisen, Beziehungsprobleme und Anpassungsstörungen entwickeln können [68].
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree