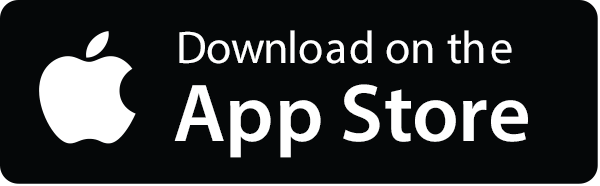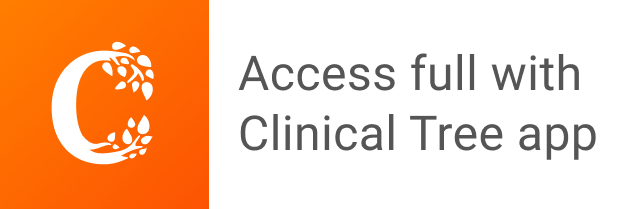Hanfried Helmchen (Hrsg.)Ethik psychiatrischer Forschung201310.1007/978-3-642-35055-9_9© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
9. Forschung zu sozialpsychiatrischen Interventionen
(1)
Unit for Social & Community Psychiatry, Barts & The London School of Medicine & Dentistry, Queen Mary University of London, Newham Centre for Mental Health, E13 8SP, London, United Kingdom
Zusammenfassung
Die meisten sozialpsychiatrischen Interventionen bestehen aus verschiedenen Komponenten und können als komplex bezeichnet werden. Die wissenschaftlichen Methoden, um solche komplexen Interventionen – z. B. in randomisierten kontrollierten Studien – zu evaluieren, haben sich in den letzten 15 Jahren erheblich weiterentwickelt. Dies kann – im Zusammenhang mit einer zunehmenden Bürokratisierung von Forschungsgenehmigungen – auch die ethische Beurteilung erschweren. Bei Anträgen an Ethikkommissionen zur Beurteilung von Studien zu sozialpsychiatrischen Interventionen ergeben sich Probleme formaler, praktischer, rechtlicher und vor allem wissenschaftlicher Natur, die in dem Beitrag illustriert werden. Zusätzliche Aspekte sind potenzielle Interessenkonflikte und die Nutzung von Forschungserkenntnissen in der Praxis.
9.1 Einführung
Die Evaluation komplexer psychiatrischer Interventionen hat sich seit den 1990er Jahren methodisch erheblich weiterentwickelt. Als komplex werden Interventionen bezeichnet, die aus mehreren Komponenten bestehen, die entweder aufeinanderfolgen oder zur selben Zeit zur Anwendung kommen [1]. Der Konvention entsprechend fallen praktisch alle psychotherapeutischen Behandlungen und sozialpsychiatrischen Interventionen unter den Begriff der komplexen Interventionen. Die Evaluation solcher Interventionen umfasst Beobachtungsstudien und quasi experimentelle Studien , vor allem aber randomisierte kontrollierte Studien , die häufig pragmatisch sind, das heißt weitgehend unter den gleichen Bedingungen durchgeführt werden, unter denen die entsprechende Intervention dann auch in der Praxis implementiert werden würde. Die ethischen Probleme, die sich dabei ergeben, unterscheiden sich nicht grundlegend von den Problemen bei anderer Art psychiatrischer Forschung, haben aber vielleicht einige besondere Aspekte. Im Folgenden werden einige der Probleme dargestellt, wobei die Beispiele der Forschungspraxis in England und dem Umgang mit den dortigen Ethikkommissionen entnommen sind.
9.2 Allgemeine Probleme
9.2.1 Ethikanträge
Ein Antrag allein bei der Ethikkommission ist inzwischen so umfangreich und formalisiert, dass der Eindruck entstehen mag, alle ethischen Probleme seien damit durchleuchtet und abgedeckt. Ein Forscher, der seinen ersten Antrag bei der Ethikkommission einreicht (im nationalen Gesundheitssystem Englands erfolgt die Einreichung der Anträge zentralisiert und elektronisch) braucht auch bei Vorliegen eines exakten und detaillierten Studienprotokolls wenigstens zwei Wochen, um sich durch alle Kästchen und Fragen des Antragsformulars zu kämpfen und die erforderlichen Informationen in die entsprechenden Boxen einzutragen. Ein klinisch tätiger Psychiater, der ohne Drittmittelressourcen eine Studie durchführen möchte, wird von den Erfordernissen dieser Anträge in der Regel entmutigt. Die Ethikanträge werden damit zu einem echten Hindernis für Forschung. Anstatt Forschung auf ethische Korrektheit zu prüfen, wird durch dieses komplizierte Antragsverfahren ein bestimmter Teil von Forschung von vornherein verhindert, und dies betrifft vor allem innovative und nichtdrittmittelgeförderte Vorhaben.
9.2.2 Aufklärung und Einwilligung
Wird ein Antrag gestellt, stellen sich Probleme formaler, praktischer, rechtlicher und wissenschaftlicher Natur. Ethikkommissionen bestehen in sehr formaler Weise auf langen Aufklärungs- und Einwilligungsschreiben (im United Kingdom sind dies zwei getrennte Formulare, in Deutschland nur eines), die nahezu alles abdecken, was von Relevanz sein könnte. Diese gute Absicht hat den Effekt, dass Patienten in der Praxis die langen Texte gar nicht zur Kenntnis nehmen, geschweige denn im Detail lesen möchten. Sie vertrauen zumeist den Forschern, die die Aufklärung vornehmen und unterschreiben die Einwilligung , ohne die schriftliche Information zur Kenntnis zu nehmen. Die formale Aufklärung kann somit zu einer Pseudoaufklärung verkommen, die die Intention ins Gegenteil verkehrt. Abhängig von der Art der Studie verpflichten sich Forscher, zunächst die Einwilligungsfähigkeit zu überprüfen und mögen auch nachfragen, ob der Patient wirklich alles verstanden hat. Wenn der Patient aber einwilligungsfähig ist und seine Einwilligungserklärung unterschreiben möchte, wird das in der Praxis immer akzeptiert, ohne dass extra geprüft würde, ob der Patient nun auch wirklich alle einzelnen Aspekte der Aufklärung hinreichend studiert hat. Die Forderung, dass Patienten immer zumindest 24 Stunden Zeit haben sollen, bevor sie sich für oder gegen eine Studienteilnahme entscheiden, wird in formal gleicher Weise auf ganz unterschiedliche Studien angewandt, die im Ausmaß der Patientenbeteiligung und der potenziellen Belastung stark variieren können. Durch diese nicht differenzierte Anwendung der allgemeinen 24-Stundenregel entsteht ein Mehraufwand für Forscher und Patient, der unsinnig ist, wenn der Patient in der gesamten Studie – z. B. einer Beobachtungsstudie – ohnehin nur wenige Fragen beantworten soll und seine Einwilligung jederzeit wieder zurückziehen kann.
9.2.3 Beurteilung tatsächlicher Belastung
In praktischer Hinsicht beurteilen die Kommissionen zum Beispiel, ob die Studie Patienten zu sehr belastet. Die tatsächliche Belastung ist aber ohne entsprechende Erfahrung sehr schwer einzuschätzen. Natürlich muss jeder Antragsteller seine eigene Beurteilung der möglichen Belastung von Patienten, wie auch von allen anderen Risiken, darstellen und dann ausführen, wie diese Risiken im Einzelfall eingeschätzt und begrenzt werden. Dieser Beurteilung braucht die Kommission aber naturgemäß nicht zu folgen. So bestand die Kommission bei einer Studie darauf, die Anzahl der Fragebögen pro Befragung zu vermindern, obwohl der beantragende Forscher bei früheren Studien exakt dieselben Fragebögen verwendete, ohne dass es je zu Schwierigkeiten oder Überforderungen gekommen wäre. Es fällt Kommissionen zuweilen schwer, zwischen mehr oder weniger belastenden und problematischen Studien zu unterscheiden, sodass mehr oder minder formale Kriterien angewendet werden, die letztlich niemandem gerecht werden.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree