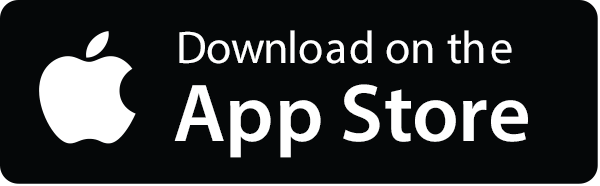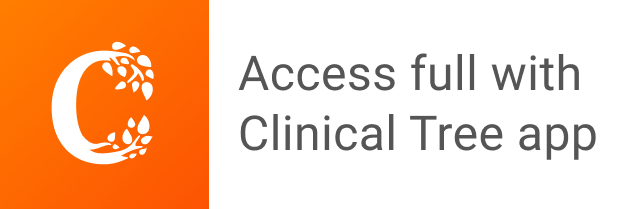Abb. 6.1
Der Teufelskreis der spätadoleszenten Verweigerung
6.5 Die Rolle des Körpers
In verschiedenen Phasen des Lebens findet keine besonders intensive Wahrnehmung des Körpers durch das Ich statt. Diese friedliche Koexistenz bleibt so lange stabil, wie der Körper nicht durch Schmerz oder andere Phänomene bzw. Veränderungen auf sich aufmerksam macht. Insbesondere in Phasen der Kindheit imponiert diese friedlich-koexistierende Bezugnahme besonders intensiv. Umso beeindruckender ist für jeden Menschen die plötzlich eintretende Labilisierung dieses Verhältnisses, durch die mit der Pubertät angestoßenen und unbeeinflussbar ablaufenden Veränderungen des eigenen Körpers und die sich daraus ergebenden subjektiven Reaktionen. In diesem Zusammenhang gewinnt die Gleichzeitigkeit von Körperlichkeit eine besondere Bedeutung. Der Körper ist gleichzeitig Teil des Selbst, wird aber auch als Objekt erlebt, das dranghafte Erfahrungen vermittelt und auch, z. B. im Dienste der Spannungsregulation , „gehandhabt“ werden kann. Beide Aspekte von Körperlichkeit gewinnen durch die Pubertät an Relevanz – allerdings nicht zum ersten Mal im Leben.
Die Notwendigkeit einer Neuentdeckung des reifenden Körpers ruft frühe Körpererfahrungen wach, die in enger innerer Beziehung zur Selbstentwicklung stehen und gleichzeitig mit den frühen Objekterfahrungen verwoben sind. Nur so sind die vehementen Körpersymptome, das autodestruktive Agieren am eigenen Körper, besonders durch junge Frauen in den Jahren nach der Pubertät, zu verstehen.
Eingerahmt wird diese Phänomenologie allerdings durch eine gesellschaftliche, anhaltend hohe Besetzung des Körpers in den letzten Jahren. Mitunter entsteht der Eindruck, dass der eigene Körper als der letzte, sicherheitvermittelnde und verlässliche Aspekt in einer Welt fantasiert wird, die immer weniger beruhigende, authentische, lustspendende Momente bereitzuhalten scheint. Partnerschaften sind Lebensabschnittsbegegnungen, berufliche Biografien immer häufiger durch Brüche, Neuorientierungen und die wiederholte Aufgabe persönlicher Beziehungen gekennzeichnet. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass Menschen in einer inneren Umbruchsituation mit den dazugehörigen Unsicherheiten in besonderer Weise eine Bezugnahme auf die wahrgenommene Umgebung vornehmen, um diese in ganz verschiedener Weise für die eigene Stabilisierung zu verwenden.
Der eigene Körper wird dann, je nach Selbstkonzept, durch Bodybuilding, exzessives Sporttreiben, Diäten oder Fastenkuren auf vermeintliche Idealmaße hin getrimmt, durch Tätowierung, Piercing, Frisur und Kleidung zum Ausdrucksinstrument und so zum Werbeträger in eigener Sache. Aus dieser Perspektive ermöglicht eine gestaltende Einflussnahme auf das äußere Erscheinungsbild auch die Fantasie der Kontrolle über eine subjektiv aus den Fugen geratenen und damit unkontrollierbar erlebten Welt. Als Vehikel bei dem Versuch, die eigene Identitätsfindung zu forcieren, wird der Körper zum Experimentierfeld, auf dem notfalls auch die körperliche Unversehrtheit zur Disposition gestellt wird. Da die körperliche Unversehrtheit und Integrität eines der letzten Tabus in den Gesellschaften der westlichen Welt darstellt, eignet sich der destruktive Angriff auf den eigenen Körper auch so hervorragend für adoleszente Provokationen. Tattoos und Piercings gehören für junge Menschen fast selbstverständlich zur Selbstinszenierung und haben den Raum der Subkultur schon lange verlassen.
Die Anerkennung des eigenen sexuellen Körpers konfrontiert unnachgiebig mit der eigenen Geschlechtsidentität. Diese Anerkennung – mit der daraus erwachsenen Ermöglichung von Intimität – ist eine der zentralen Entwicklungsaufgaben, deren Bewältigung am Ende der Adoleszenz zunehmend erprobt und damit auch „evaluiert“ werden muss. Das Gelingen oder Scheitern dieser Aufgabe steht in einem ausgesprochen engen Zusammenhang mit all den anderen Aufgaben, die zur Bewältigung anstehen. Der großen Bedeutung der Integration des veränderten Körpers in die Gesamtpersönlichkeit und der Störfälligkeit dieses Prozesses, die Vielzahl von auf den Körper bezogenen, in oder am Körper stattfindenden Symptombildungen in der Lebensphase des Übergangs zum Erwachsenen sollten in den Behandlungen junger Erwachsener unbedingt berücksichtigt werden. Auch wenn keine manifeste Essstörung, kein selbstverletzendes Verhalten oder eine andere eindrückliche Symptombildung vorliegt, spielen der Körper, das Körperbild und der Umgang mit ihm doch eine wichtige, aber oft wenig wahrgenommene Rolle für die Gesamtproblematik. Als Beispiel sei auf das insgesamt wenig beachtete Phänomen der Dysmorphophobie hingewiesen. Obwohl dysmorphophobe Ängste in der Pubertät als normaler Bestandteil der Entwicklung eingeschätzt werden (DuBois1990), finden sie in der Literatur nur sehr wenig Erwähnung. Es ist wichtig zu betonen, dass in keiner anderen Lebensphase die systematische Einbindung des Körpers in komplexe klinische Symptomatologien so regelmäßig zu beobachten ist wie in der Spätadoleszenz. Dabei geht es um den Körper in seiner konkreten Dimension, aber mehr noch um die bewussten und unbewussten Zuschreibungen: den Körper als Objekt, dessen innere Repräsentanz, den Körper als Ursprung eines unbekannten Begehrens und den Körper als Ziel der Begierde des Anderen. Insofern ist der Körper als Ort der Inszenierung des unbewussten Konflikts so geeignet, findet er so häufig Verwendung im agierenden Bewältigungsversuch.
Die Brisanz der Aufgabe der Integration wird daran erkennbar, dass der Körper meist mit Beginn der mittleren Adoleszenz – ggf. auch etwas später – im Kontext der Symptombildungen eine gänzlich andere Verwendung findet als im Kindesalter. Während der Körper auf der Symptomebene im Kindesalter überwiegend mit Störungen, die die Kontrolle einzelner Körperfunktionen betreffen (Enuresis , Enkopresis , ADHS etc.), in Erscheinung tritt, dominieren ab der (mittleren) Adoleszenz bis in das junge Erwachsenenalter hinein eher Symptombildungen, die den Körper in seinem veränderten Erscheinungsbild und mit seinen neuen Bedürfnissen massiv bekämpfen (Tab. 6.1). Dazu zählen die genannten dysmorphophobischen Befürchtungen und hypochondrische Ängste, anorektische und bulimische Essstörungen , selbstverletzendes Verhalten und mitunter auch ein agierender Umgang mit somatischen Grunderkrankungen. All diese Symptombildungen können auch als Versuch interpretiert werden, die Integration des Körpers oder einzelner Aspekte in ein neues Selbstkonzept aufzuschieben oder sogar zu verhindern.
Tab. 6.1
Verschiedene Formen der Einflussnahme auf den Körper und ihre innerseelische Funktionen
Symptomatik | Abgewehrte Entwicklung |
|---|---|
Körperdysmorphe Befürchtungen | Integration des sexuellen Körpers in das Selbstkonzept |
Hypochondrische Ängste | Verantwortungsübernahme für eigene expansiv-triebhafte Wünsche |
Bulimie | Generativität, erwachsene Aggressivität |
Anorexie | Weiblichkeit, Autonomie, Triebhaftigkeit, Hingabe, Verschmelzung |
Selbstverletzendes Verhalten | Zärtlichkeit, Intimität, Sexualität |
Es fällt auf, dass die genannten Störungen eher zu den schwerer zu behandelnden Erkrankungen des Fachgebiets der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie zählen. Auch eine jahrzehntelange Diskussion und die Erprobung ganz unterschiedlicher Behandlungskonzepte, die von einer gewährenden, um Verstehen bemühten Grundhaltung bis hin zu rigide-kontrollierenden Ansätzen reichen, hat an dieser Einschätzung erstaunlich wenig verändern können.
Möglicherweise verschafft der mit diesen Erkrankungen unmittelbar verbundene Tabubruch den Betroffenen eine besondere (unbewusste) Genugtuung. In einer Zeit, die zumindest in der westlichen Welt seit Jahrzehnten ohne kriegerische Auseinandersetzungen auskommt, in der die körperliche Integrität des Einzelnen auch nicht mehr durch Epidemien oder berufliche Risiken gefährdet ist und in der für eine Vielzahl chronischer somatischer Erkrankungen wirkungsvolle Therapieansätze entwickelt worden sind, hat sich die körperliche Unversehrtheit fast zu einem moralischen Anspruch entwickelt.
Den eigenen Körper im Kontext autodestruktiver Symptombildungen (scheinbar willentlich) in einer derart kompromisslosen Art und Weise zu attackieren, mobilisiert im Umfeld der Betroffenen – sowohl im familiär-freundschaftlichen als auch im therapeutischen Rahmen – in der Regel eine ausgeprägte Resonanz.
Vermutlich auch relevant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die psychosomatische Medizin selbst ein schwieriges Verhältnis zum Körper entwickelt hat, das sich in dem Feld zwischen einer weitgehenden Leugnung der Körperlichkeit in der Psychosomatik analytischer Prägung, einer sich des Körpers bemächtigenden Haltung mancher körpertherapeutischer Schulen und einem objektivierenden Zugang zu subjektiv-körperlichen Vorgängen der akademischen Psychosomatik abspielt. Das Verhältnis ist aber niemals unbefangen gewesen. Diese Entwicklung erstaunt insofern in besonderem Maße, als S. Freud schon 1923 auf die überaus komplexen Verhältnisse von Körper und Seele hingewiesen hat: „Der eigene Körper und vor allem die Oberfläche desselben ist ein Ort, von dem gleichzeitig äußere und innere Wahrnehmungen ausgehen können. Er wird wie ein anderes Objekt gesehen, ergibt aber dem Getast zweierlei Empfindungen, von denen die eine einer inneren Wahrnehmung gleichkommen kann. […] Das Ich ist vor allem ein körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche“ (S. Freud 1923, S. 253).
Körperdysmorphe Störung
Sicherlich zu wenig Beachtung im Bereich der Psychosomatik und Psychotherapie findet das Phänomen der Dysmorphophobie oder besser (entsprechend dem DSM-IV) die körperdysmorphe Störung. Die Bezeichnung „körperdysmorphe Störung“ erscheint insofern zutreffender, als ein klassisches Kriterium einer Phobie, nämlich die Angstfreiheit durch Vermeidung der furchterregenden Situation, bei der Dysmorphophobie nicht gegeben ist.
Die Problematik nimmt ihren Ausgang meist in der Adoleszenz oder spätestens in der Spätadoleszenz. Häufig ist der Beginn einer körperdysmorphen Störung in der Adoleszenz (16. bis18. Lebensjahr) oder in der Spätadoleszenz (18. bis 21. Lebensjahr) als Bestandteil einer sogenannten Adoleszentenkrise auszumachen. Dies steht sicherlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabe, den eigenen, veränderten und geschlechtlichen Körper anzuerkennen und zum Teil eines kohärenten Selbstkonzeptes werden zu lassen. Ebenso unsicher wie das Schicksal einer Adoleszentenkrise ist die weitere Entwicklung einer körperdysmorphen Störung. Sie kann als passager auftretendes Phänomen wieder verschwinden, sich aber auch zu einem persistierenden Symptombild auswachsen (Salge 2011).
Von verschiedenen Autoren werden anhaltende körperdysmorphe Störungen mit schwerwiegenden Störungen der Persönlichkeitsentwicklung in einen engen Zusammenhang gerückt (Feldman 1975; Joraschky u. Moesler 1983). Sicherlich ist es ein ernst zu nehmender Hinweis auf eine pathologische Entwicklung, wenn die „physiologischen“ körperdysmorphen Befürchtungen eines Jugendlichen zum Ende der Adoleszenz bestehen bleiben oder sich sogar akzentuieren und Handlungsimpulse nach sich ziehen.
Die schwer oder kaum korrigierbare Angst, dass der Körper oder Körperteile missgebildet, unansehnlich, zu klein oder zu groß sind, lässt die Betroffenen viel Zeit vor dem Spiegel verbringen (Abb. 6.2). Mitunter werden aber auch alle Spiegel und reflektierenden Oberflächen in der Wohnung verhängt. Die Betroffenen beschäftigen sich oft mehrere Stunden am Tag mit Gedanken hinsichtlich ihrer „Entstellung“ bzw. deren Kaschierung durch Kleidung oder Make-up. In sozialen Situationen, sofern sie nicht grundsätzlich gemieden werden, führen Vergleiche mit Anderen zur Intensivierung der Befürchtungen, mit der Folge eines zunehmenden sozialen Rückzugs. Betroffene vermeiden es oft, auf Fotos abgelichtet zu werden. Es erfolgt in progredienter Form eine konsequente und vollständige Attribuierung aller Lebensschwierigkeiten und Probleme auf das Aussehen, d. h. den fantasierten Makel. Die dysmorphophoben Befürchtungen werden am häufigsten im Bereich des Gesichts und an den sekundären Geschlechtsmerkmalen lokalisiert (Salge 2011).
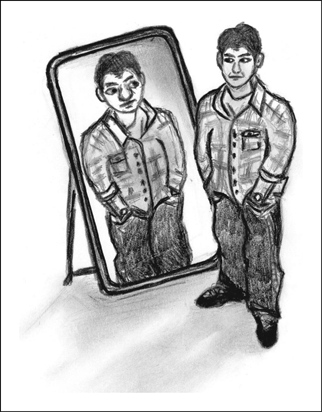
Abb. 6.2
Absolut sicher – so wie ich aussehe, kann mich keiner mögen. (Mit freundlicher Genehmigung von Niklas Krönke)
Der Versuch des in seiner Identität gestörten Patienten, seine „Minderwertigkeit“ auf vermeintlich defizitäre Aspekte seines Äußeren zu projizieren, führt zwangsläufig zu einer Forderung nach somatischer Therapie. Insofern adressieren Betroffene ihre Wünsche nach einer Problemlösung über lange Zeit zunächst an Dermatologen, HNO-Ärzte, Gynäkologen, plastische Chirurgen und Zahnärzte. Besonders problematisch kann diese Entwicklung in der Spätadoleszenz werden. Die Volljährigkeit erlaubt nun die eigenständige Einwilligung zu operativen Eingriffen. Zudem ermöglicht der eigene Zugang zu ökonomischen Ressourcen, also z. B. eigenes Einkommen – unabhängig von den Eltern – zu erwirtschaften, die entsprechenden Eingriffe zu finanzieren.
Fallvignette
Bei der ersten Begegnung ist die Patientin, eine Jurastudentin, 21 Jahre alt. Sie ist Einzelkind wohlhabender Eltern, die seit einigen Jahren getrennt leben. Die Mutter leidet seit vielen Jahren an einer rheumatischen Erkrankung. Bis zum Zeitpunkt des Erstkontaktes hatte die junge Patientin bereits eine zweimalige Nasenkorrektur, eine Brustkorrektur, ein mehrfaches „Aufspritzen“ der Lippen in fünf- bis achtmonatigen Abständen vornehmen lassen und es waren Operationskosten von etwa 9.000 Euro entstanden. Bei Erhebung der Anamnese tritt eine Vielzahl von Schwierigkeiten in Erscheinung. Es fällt der jungen Frau ausgesprochen schwer, ihr Studium libidinös zu besetzen. Auch viele andere Dinge im Leben bereiten ihr nicht wirklich Freude. Sie scheint weitgehend in einem alexithym anmutenden Modus gefangen, hat kaum erkennbare Kontaktmöglichkeiten zur eigenen inneren Welt. In der mehrwöchigen stationären Psychotherapie, gefolgt von einer fast zweijährigen ambulanten, analytisch orientierten Gruppenpsychotherapie kann sich die Patientin zwar von ihren dysmorphophoben Befürchtungen distanzieren und auf weitere korrigierende Eingriffe verzichten. Der Abschluss des Studiums ist ebenso möglich wie der Übergang ins Berufsleben. Eine echte libidinöse Besetzung fällt der jungen Frau aber weiterhin ausgesprochen schwer. Im Rahmen einer ersten Partnerschaft sind ihr sexuelle Begegnungen möglich, eine (bagatellisierte) Erlebnisunfähigkeit bleibt allerdings bestehen. Auch eine echte Ablösung aus der gegenseitigen, überaus vereinnahmenden und symbiotisch anmutenden Beziehung zur Mutter gelingt zunächst nicht.
Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen auf das Vorliegen einer körperdysmorphen Störung, die in der überwiegenden Zahl allerdings als gehandelte Botschaften in Erscheinung treten und vom Betroffenen selbst meist nicht problematisiert werden. Hinweise für das Vorliegen einer körperdysmorphen Störung sind (Salge 2011):
häufiges Überprüfen des äußeren Erscheinungsbildes im Spiegel;
Vermeiden von Spiegeln, weil der Anblick des eigenen Körpers unerträglich erscheint;
anhaltende Versuche, andere Menschen zu überzeugen, dass etwas am äußeren Erscheinungsbild nicht in Ordnung sei;
hoher Zeitaufwand für die Überprüfung bzw. Korrektur des eigenen Erscheinungsbildes;
Klagen von Familienmitgliedern über eine ständige Nutzung des Bades;
unangemessenes Bedecken oder Verstecken von Körperteilen mit Hut, Kleidung, Make-up, Sonnenbrillen oder den eigenen Haaren;
Schwierigkeiten, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, wenn keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden konnten;
hartnäckige Überzeugung, von anderen Menschen angeschaut und/oder negativ beurteilt zu werden;
hoher Zeitaufwand zur Beschaffung von Informationen zur Korrektur oder Verschönerung des eigenen Körpers;
hartnäckiger Wunsch nach plastisch-ästhetischer Behandlung, um das körperliche Erscheinungsbild zu korrigieren, obwohl andere Menschen dies für unnötig erachten;
Unzufriedenheit mit einem durchgeführten plastisch-ästhetischen Eingriff;
häufige Verspätungen aufgrund des hohen Zeitaufwands für die Korrektur des körperlichen Erscheinungsbildes;
Schwierigkeiten, Komplimente in Bezug auf das eigene Erscheinungsbild anzunehmen;
Schwierigkeiten, den Körper entblößt zu zeigen (Strand, Sauna, Schwimmbad);
Schwierigkeiten in oder Vermeiden von sexuellen Beziehungen.
Ein weiteres Feld, auf dem Menschen mit körperdysmorphen Störungen nach einer Lösung für ihre Schwierigkeiten suchen, ist die sogenannte „Bodymodification “. Die massive Zunahme von Piercings und Tattoos sowie von Bodybuilding und Bodystyling im zurückliegenden Jahrzehnt hat vielfältige Interpretationen von soziologischer und psychologischer Seite auf den Plan gerufen. Diese Maßnahmen bieten den Betroffenen die Gelegenheit, zunächst weitgehend unbemerkt (und auch kostengünstiger als durch operative Eingriffe) Einfluss auf ihr Äußeres zu nehmen, einen fantasierten Makel zu beseitigen, einer befürchteten Unvollkommenheit aktiv entgegenzutreten.
6.6 Sexualität
Aus dem weiten Feld dieser Thematik möchte ich hier, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, nur einige Aspekte herausgreifen, die für das Thema dieser Arbeit von besonderer Relevanz erscheinen. Sexualität als soziokulturelles Phänomen ist in den zurückliegenden 100 Jahren einem bedeutenden Wandel unterlegen. Die kritische Theorie stellte schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Degeneration der Sexualität unter den Einflüssen der Industriegesellschaft zur Ware heraus (Horkheimer u. Adorno 1947).
Die sexuelle Revolution hat zunächst zu einer Liberalisierung sexuellen Verhaltens beigetragen. Die Frauenbewegung und auch die zunehmende Ökonomisierung der westlichen Welt haben zu einer Neuordnung der traditionellen Geschlechterverhältnisse geführt, die auch die sexuellen Beziehungen nicht unberührt lassen. Die Erscheinungsformen der Sexualität sind ausgesprochen vielfältig geworden. Alles scheint möglich. Inzwischen erscheinen fast alle Lebensbereiche mehr oder weniger sexualisiert.
Allerdings verraten diese Erscheinungsformen von Sexualität im gesellschaftlichen Diskurs, ihre Verwendung für kommerzielle Zwecke sowie die scheinbare Befreiung von normativen Zwängen und gesellschaftlichen Sanktionen wenig über die Aneignungsmöglichkeiten der sexuellen Wünsche und Bestrebungen des Einzelnen. Gerade durch die Allgegenwärtigkeit von Sexualität wird der Blick auf die unbewusste Dynamik von Intimitätswünschen, dranghaftem Wollen, Aggressivität, Hingabewünschen , Zärtlichkeitsbedürfnissen und der eigenen Elternschaft – also Aspekten, die alle in der sexuellen Erfahrung zusammentreffen – verstellt. Dabei entsteht der Eindruck, dass es in zunehmendem Maße zu einer selbstverständlichen Auftrennung von Erfahrungsdimensionen kommt, die in der Vergangenheit ebenso selbstverständlich miteinander verbunden waren. Es dominiert der Trend zu einer ständigen Inszenierung des eigenen Körpers im Dienste der narzisstischen Regulation, die keinen Bezug zu Erfahrungen der intimen Begegnung, den damit verbundenen Ängsten, Irritationen, aber auch Befriedigungsmöglichkeiten mehr zu haben scheint. Die Sexualität scheint aus dieser Perspektive ihrer triebhaften Komponente ebenso entledigt wie ihrer erotisch-zärtlichen und auch ihrer generativen Dimension.
Diese gesellschaftliche Entwicklung in der Verwendung von Sexualität, die zunehmende Herauslösung aus dem Bereich der privaten Erfahrung ist paradoxerweise als notwendige Folge der Liberalisierung, als eine neue Form der Kontrolle zu verstehen: „Von der Sexualität geht beständig die Gefahr der Verführung zu einem genussvollen anderen Leben und zur Ablenkung von Arbeit aus“ (Neuberger 2002, S. 812). Insofern schafft die Sexualität auch immer eine Zone der Ungewissheit. Im aktuellen Umgang mit dieser Ungewissheitszone kommt es möglicherweise zu einer problematischen Kollusion zwischen dem immerwährenden Wunsch nach Bewältigung der grundsätzlichen Beunruhigung, die Sexualität in ihrer Tiefe – allen libertären Entwicklungen zum Trotz – immer noch mobilisiert, und dem Vermeidungsbedürfnis junger Erwachsener den anstehenden Entwicklungsanforderungen gegenüber.
Besonders die medialen Botschaften einschlägiger Fernsehformate („Deutschland sucht den Superstar“ oder „Germany’s Next Topmodel“), die sich gerade bei jüngeren Zuschauern ausgesprochen großer Beliebtheit erfreuen, forcieren die Inszenierung des Körpers als scheinbarer Befriedigungsmöglichkeit, verbunden mit der Botschaft: „Anschauen, aber nicht anfassen; bewundert werden, ohne sich innerlich berühren lassen.“ Auf diese Weise wird Sexualität inszeniert, aber nicht erfahren. Die ständige Präsenz von Sexualität und deren Vermarktung erleichtern die individuelle Integration des Sexuellen nicht, sondern bewirken vielmehr das Gegenteil. Die Idolisierung des Körpers ist in seiner Abwehrfunktion hoch evident. Michael Günther (2010, S. 58) schreibt dazu: „Unter dieser Perspektive sind derartige Medienformate mit ihrer narzisstisch-sexualisierten Selbstinszenierung als Abwehrformationen gegen das unverträglich einbrechende Sexuelle zu lesen, das die Gesellschaft wie das Individuum zu zerstören droht. Wie jede Abwehr stellen sie aber auch, so ist durchaus einzuräumen, schützende Rückzugsgebiete in die Phantasie dar, wenn die Anforderungen der sexuellen Entwicklung und damit von Intimität und Nähe auf der einen Seite und Ablösung und Verselbständigung auf der anderen Seite zu heftig erscheinen.“
Die oft zur Schau gestellte Sicherheit junger Erwachsener in Bezug auf den eigenen Körper und die Sexualität kann sich als pseudoprogressive Bewegung entpuppen bzw. auch zu einem Entwicklungskurzschluss führen. Die Ablösung der auf das Objekt zielenden Bereiche der Sexualität und die Fokussierung auf seine bewunderungspendenden Blicke sind aus dieser Sichtweise ein Teil des Versuchs, die unbewusste Dimension von Sexualität zu leugnen und der mit ihr immer verbundenen Beunruhigung zu entgehen. Diese Dimension nimmt ganz unmittelbar auf die Schwellensituation der Spätadoleszenz Bezug. Sexualität jenseits ihrer narzisstischen Dimension verweist immer auch auf die eigene Generativität , den damit verbundenen Generationenwechsel, auf der unbewussten Ebene auf die ödipale Thematik und die damit verbundenen Konflikte.
Die narzisstische Körperinszenierung unter Verwendung der unzähligen makellosen und märchenhaft-unschuldig, z. T. auch androgyn anmutenden Identifikationsangebote korrespondiert mit einem (unbewussten) Bedürfnis nach einem Leben in ewiger Unschuld. Die Unmöglichkeit, sich von diesem Wunsch endgültig zu verabschieden, kann für junge Menschen zu einem nachhaltigen Hemmnis der eigenen Entwicklung gerinnen. Die eigene Sexualität kann auf diese Weise zu einer Behauptung werden, die keiner Überprüfung ausgesetzt wird. Oder es resultiert ein ausweichender Umgang mit der Thematik, der mit einer ständigen Angst vor Entlarvung einhergeht.
Fallvignette
Eine 24-jährige Studentin schildert, wie konsequent sie ihre fehlenden partnerschaftlichen Erfahrungen über mehrere Jahre ausgesprochen beschämt und selbstvorwürflich verarbeitet hat. Schließlich habe sie im Alter von 23 Jahren beschlossen, sich einen Freund „zu suchen“. Die sexuellen Begegnungen, zu denen sie sich geradezu zwingt, werden aufgrund einer ausgeprägten Dyspareunie zum Desaster. Nach der Trennung bleibt sie mit ihrer Beschämung zunächst allein. Zur Stabilisierung ihres inneren Gleichgewichts identifiziert sie sich in der Folge mit der Bewegung der Asexualität. Erst im Rahmen einer zweijährigen Psychotherapie wird es ihr möglich, sich mit ihrer unsicheren weiblichen Identität und ihrer ausgeprägten Hingabestörung auseinanderzusetzen und sich kleinschrittig ein authentisches Interesse an ihrem weiblichen Körper zu erarbeiten, das ihr schließlich einen langsamen, ausprobierenden und ihr entsprechenden Umgang mit ihren sexuellen Bedürfnissen ermöglicht.
Für die spätadoleszenten Entwicklungsaufgaben, der Fähigkeit zur Intimität, der Stabilisierung der eigenen Geschlechtsidentität und der Integration des sexuellen Körpers in das Selbstkonzept kommt den gelebten Liebes- und Intimbeziehungen ein besonderer Stellenwert zu. Ausgehend von der bereits formulierten Überlegung, dass der Spätadoleszenz ein Moment der Bilanzierung zukommt, werden gerade hier die bisher erworbenen Voraussetzungen angefragt, die darüber entscheiden, ob das Wagnis zu authentischen Begegnungen eingegangen werden kann. Wenn eine zuvor gestörte Entwicklung dazu führt, dass die eigenen Wünsche und Fantasien zu große Erschütterungen befürchten lassen und archaische Ängste mobilisieren, können intensive Beziehungen und besonders Intimbeziehungen nicht eingegangen werden.
Sexuelle Wünsche und Impulse werden dann entweder durch Attacken auf den dafür „verantwortlichen“ Körper (besonders bei jungen Frauen) oder durch regressive Rückzüge in eine weitgehend geschlechtslose Welt (besonders bei jungen Männern) beantwortet. In einer weiteren Variante erfolgt die Reduzierung auf die beschriebene narzisstische Selbstinszenierung des Körpers. Oder geschlechtliche Beziehungen werden realisiert bzw. konsumiert, ohne mit Erfahrungen von echter Begegnung, Lusterleben, Leidenschaft und Intimität verbunden zu werden. In all diesen Variationen können die Chancen des Möglichkeitsraums Sexualität für die Stabilisierung der eigenen Identität, die Anerkennung von eigener möglicher Elternschaft und die damit verbundene Reorganisation der inneren Objektwelt nicht genutzt werden. Die Möglichkeit, auch in anderen Lebensbereichen intensive libidinöse Besetzungen zu wagen, scheint nach meiner klinischen Erfahrung eng mit den Erfahrungen im sexuellen Übergangsraum zu korrespondieren.
Psychische Erkrankung in der Spätadoleszenz geht nach meiner Wahrnehmung in vielen Fällen mit erheblichen sexuellen Schwierigkeiten einher. Diese Einschätzung wird vor dem Hintergrund der zuvor getroffenen Feststellungen nicht allzu sehr überraschen. Damit gewinnt die Frage nach der Art und den Möglichkeiten des Umgangs im therapeutischen Prozess mit diesen Schwierigkeiten, die häufig ein hohes Maß an Abwehr- oder Copingmanövern hervorrufen, an Relevanz.
Fallvignette
Frau B. begibt sich kurz vor dem Abitur erstmalig in ambulante Psychotherapie. Nachdem sie das therapeutische Angebot zunächst für eine Stabilisierung nutzen kann, kommt es bald nach Aufnahme eines Studiums zu einer ausgeprägten Zunahme ihrer depressiven Symptome mit latenter Suizidalität und besonders zu exzessiven Selbstverletzungen, was eine erste stationäre Behandlung notwendig macht. Schon während dieses ersten Aufenthaltes wird die erhebliche weibliche Identitätsunsicherheit der jungen Frau deutlich. Diesbezüglichen therapeutischen Interventionen weicht die junge Patientin aber systematisch aus. Eine weitere suizidale Krise kurz vor Abschluss des Studiums führt zu einem zweiten stationären Aufenthalt. In hoch ambivalenter Form versucht Frau B. nun, auf ihre sexuellen Schwierigkeiten Bezug zu nehmen, indem sie ihre „asexuelle“ Orientierung proklamiert. Zunächst empört, bald aber beschämt und im weiteren Verlauf auch dankbar reagiert die Patientin, als die Gruppe der Mitpatienten sehr klar, aber auch sehr zugewandt den Abwehrcharakter ihrer Darstellung herausarbeitet und sehr konsequent erotische Bedürfnisse aus den Begegnungen im gemeinsamen Klinikalltag bei ihr identifiziert.
Als zentraler Aspekt und somit auch als Parameter bleibt allerdings die Tatsache bestehen, dass unabhängig vom Zeitgeist und der gesellschaftlichen Repräsentanz von Sexualität die Herausbildung einer endgültigen sexuellen Identität eine der Hauptaufgaben der Spätadoleszenz und des jungen Erwachsenenalters ist. Vermutlich führt aber die vordergründige Liberalisierung, Allgegenwart oder sogar Profanisierung der Sexualität gerade nicht zu besseren Aneignungsmöglichkeiten des sexuellen Körpers und zu größeren Möglichkeiten für einen experimentierenden Umgang mit dem eigenen Erleben und Verhalten für den Einzelnen im Verlauf seiner persönlichen Entwicklung.
Fallvignette
Frau B. ist 21 Jahre alt, als sie zu einer mehrmonatigen stationären Psychotherapie in die Klinik kommt. Sie weist eine Reihe borderlinetypischer Symptome und Verhaltensweisen auf. Im Verlauf der sich anschließenden, insgesamt sechsjährigen ambulanten modifizierten analytischen Psychotherapie mit zwei Wochenstunden im Sitzen treten während einer längeren Behandlungsphase zunächst das Partnerschaftsverhalten und später auch das Sexualverhalten der jungen Frau in den Fokus. Während sie in vielen Bereichen ihres Lebens mit ihren Schwierigkeiten hadert, ihre familiären Konflikte, Schwierigkeiten und ihr Scheitern bezüglich ihrer Ausbildungssituation, ihren Alkohol- und Drogenmissbrauch und auch ihre immer wieder destruktiv anmutende Partnerwahl in sehr selbstvorwürflicher Art und Weise thematisiert, scheint sie auf ihre Sexualität, ihre Möglichkeit, Männer durch ihr Sexualverhalten zumindest kurzfristig für sich zu begeistern, insgeheim sehr stolz zu sein. Erst im letzten Behandlungsabschnitt, als sich die Patienten erstmalig auf eine längere, verbindlichere und damit auch zukunftsorientiertere Partnerschaft einlassen kann, treten ihre erheblichen sexuellen Erlebnisschwierigkeiten zutage. Sukzessive lässt sich herausarbeiten, dass sie sich in der Vergangenheit wie selbstverständlich in ihrem Sexualverhalten an Vorbildern aus pornografischen Filmen orientiert und letztlich vollständig darauf verzichtet hat, eine eigene Sexualität in einem ausprobierenden Modus zu entwickeln.
6.7 Besondere Abwehrkonfigurationen junger Erwachsener
Als Erste hat Anna Freud (1936) auf die Besonderheiten in den Abwehr konfigurationen Jugendlicher hingewiesen. Dabei sind es besonders zwei Bewegungen, auf die sie aufmerksam gemacht hat: die Pubertätsaskese und die Neigung zur Intellektualisierung. Aufgrund der nicht ausgereiften Ich-Funktionen beim Jugendlichen werden zur Bewältigung der impulshaft andrängenden Wünsche und Bedürfnisse in der Zeit nach der Pubertät sehr rigide Manöver benötigt, um die Gefahr, das innere Gleichgewicht endgültig zu verlieren, zu bannen. Dabei soll die Askese, die auch nicht zwischen verschiedenen Bedürfnissen unterscheidet, eher die Impulse aus dem Triebbereich in Schach halten, die Intellektualisierung den innerlich aufwühlenden, emotionalen Stürmen entgegentreten (A. Freud 1936).
Da psychische Erkrankung in der Spätadoleszenz immer mit einer Vermeidung von Entwicklung in einem engen Zusammenhang steht, ist mit einer Persistenz von (unbewussten) Strategien und Abwehrbewegungen zu rechnen, die in der vorangegangenen Lebensphase in großer Regelmäßigkeit Verwendung gefunden haben und als Übergangsphänomen kaum Anlass zur Sorge geben. Da die fehlgeschlagene Entwicklung das beanspruchte Ich in seinen Regulationsbemühungen nicht zur Ruhe kommen lässt, ein Zuwachs an Handlungsfähigkeit und Stabilitätserleben nicht in der benötigten Kontinuität eintritt, ist weiterhin ein Rückgriff auf die rigiden Abwehrmechanismen notwendig. An die Stelle der Pubertätsaskese scheint aktuell aber eher die aufwendige, oft kompromisslose Formung des eigenen Körpers zu treten. Durch regelmäßige, eventuell auch exzessive körperliche Betätigung, gegebenenfalls begleitet von der Befolgung strenger Ernährungsvorgaben, wird der eigene Körper zum Instrument der Selbstinszenierung und zum Feind gleichermaßen.
In der psychotherapeutischen Behandlung Spätadoleszenter spielt insofern auch das Agieren immer eine bedeutsame Rolle. Dabei erscheint mir schon jetzt der Hinweis ausgesprochen wichtig, dass die Handlungsbotschaften junger Erwachsener, vermutlich unter dem Einfluss der zunehmenden kognitiven Möglichkeiten und bewusster wahrgenommener Beschämungsbefürchtungen, subtiler in Erscheinung treten werden als bei jugendlichen Patienten. Somit besteht eine größere Gefahr, dass sich der Inhalt der gehandelten Botschaften dem Therapeuten nicht vermittelt und somit dem therapeutischen Prozess verloren geht.
6.8 Die Welt der Tagträume
Tagträume und Fantasiewelten sind Teil jeder Biografie. Sie treten in jeder Lebensphase auf und sind an keine besonderen Bedingungen gebunden. Tagträume sind ein ubiquitäres Phänomen, ihre Funktion scheint vielfältig zu sein. Jedem Menschen sind diese tranceartigen Zustände bekannt, in denen die Welt der Fantasie mehrmals am Tag für kürzere oder längere Momente die Oberhand gewinnt. Auch der stabilisierende, wunscherfüllende Charakter dieser Rückzüge in die Welt der eigenen Fantasien ist den meisten Menschen unmittelbar zugänglich. In der Regel treten sie im Zusammenhang mit intellektuell wenig anspruchsvollen Tätigkeiten auf. Über den Inhalt von Tagträumen wird in der Regel nicht gesprochen. Hier besteht ein bemerkenswertes Tabu.
In der Adoleszenz kommt den Tagträumen vermutlich eine Reihe von Funktionen zu. Laufer (1980) hat auf den Tagtraum als eine Modalität hingewiesen, an dem sich die „zentrale Masturbationsfantasie“ zu erkennen gibt. Dieser Vorstellung folgend, wächst dem Tagtraum, der damit verbundenen Möglichkeit, eine Vielzahl von eigenen Seins- und Handlungsvarianten immer wieder neu in verschiedenen Varianten zu erproben, ohne wirkliche Konsequenzen tragen zu müssen, eine erhebliche Bedeutung bei der Entwicklung des Ich-Ideals zu. Chasseguet-Smirgel (1981) hat Tagträume in der Zeit der mittleren Adoleszenz auch entsprechend als Entwicklungsprogramm zum Großwerden bezeichnet. Der Tagträumer ermöglicht sich in Zeiten oder Momenten der inneren Instabilität Fantasien von Beziehungen in vollständiger Harmonie und Bezogenheit (Abb. 6.3). Solche Vorstellungen können dabei behilflich sein, Gefühle der Verlorenheit, die unweigerlich mit einer Zunahme des eigenen Explorationsverhaltens und der Realisierung von Verselbstständigungsbestrebungen einhergehen, auszuhalten. Diesem Verständnis folgend helfen Tagtraumwelten in bestimmten Phasen der Entwicklung, die Fähigkeit zum Alleinsein zu stabilisieren. Während man die Entwicklung von Fantasiewelten und sogar deren exzessive Verwendung in der frühen und mittleren Adoleszenz insofern als normalpsychologisches Phänomen einschätzen kann, haben Tagtraumwelten in der Spätadoleszenz und im jungen Erwachsenenalter eine andere Funktion. Sie dienen jetzt eher der Aufrechterhaltung von Omnipotenz- und Grandiositätsfantasien im Dienste der Bewältigung enttäuschender oder ausbleibender Lebenserfahrungen. Damit verweist das Festhalten an oder der Ausbau von Tagtraumwelten mit zunehmendem Alter auf erhebliche Lebensschwierigkeiten und kann durchaus als Indikator von pathologischen Entwicklungen angesehen werden.
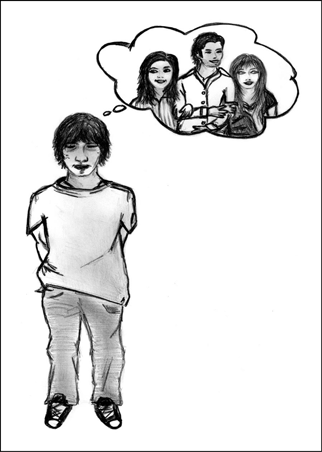
Abb. 6.3
Stabilisierung durch Tagträume und Grandiositätsfantasien. (Mit freundlicher Genehmigung von Niklas Krönke)
Ernst Bloch (1985) stellt in seinem Hauptwerk einen Zusammenhang zwischen der Hoffnung und dem Tagtraum her. Der Tagtraum erfährt somit eine philosophische Interpretation. Erwachsenwerden bedeutet sicherlich auch die Aufgabe oder Relativierung persönlicher Hoffnungen im Zuge der Ich-Ideal-Konsolidierung und der Über-Ich-Stabilisierung. Die verschiedenen, zunächst unverbindlichen Optionen für das eigene Leben prägen den Inhalt vieler jugendlicher Tagträume. Das innere Festhalten an ausgedehnten Tagtraumwelten im jungen Erwachsenenalter korreliert hochgradig mit dem Verzicht, dem eigenen Leben in verantwortungsvoller Weise eine Richtung zu verleihen. Das Ergreifen von Initiative und der Versuch, persönliche Ziele zu erreichen, beinhalten immer die Möglichkeit des persönlichen Scheiterns. Die mit den Tagträumen zunächst verbundenen bewussten Hoffnungen bezüglich der Entwicklung des eigenen Lebens werden schleichend und unbemerkt zur Manifestation einer unbewussten Hoffnungslosigkeit. Der utopische, aber gleichzeitig auch erregend-irritierende Charakter dieser seelischen Aktivität geht verloren und weicht einem zunehmenden Befriedigungscharakter. Da der Tagtraum dieses Typus oft realer erlebt wird als die Erfahrungen in der Außenwelt und ausgesprochen Ich-synton organisiert ist, eignet er sich in so besonderer Weise zur Aufrechterhaltung einer durch Leugnung und Vermeidung gekennzeichneten passiv-abwartenden Lebenshaltung. Die äußere Realität kann nur so lange akzeptiert werden, wie die eigene innere Realität nicht durch deren Wahrnehmung gefährdet wird. Konfrontiert die Außenwelt mit Anforderungen, ermöglicht sie nicht eine sofortige Befriedigung oder Beruhigung, wird unmittelbar die sehr viel befriedigendere und den eigenen Gesetzen gehorchende Tagtraumwelt aufgesucht.
Erst nachdem ich in den zurückliegenden Jahren begonnen habe, mein Augenmerk systematischer auf dieses Phänomen zu richten, im klinischen Material konsequenter nach Hinweisen auf die innere Verwendung von Tagträumen und Fantasiewelten für die Stabilisierung des inneren Gleichgewichts zu suchen, bin ich auf die Häufigkeit und auch bemerkenswerte Konsequenz aufmerksam geworden, mit der jüngere Patienten versuchen, ihre innere Balance durch den Rückzug in diese Welten aufrechtzuerhalten. Auch wenn es in der Regel gar nicht oder – wenn überhaupt – erst spät im Verlauf einer Behandlung möglich ist, Genaueres über die Inhalte dieser sehr geschützten Vorstellungswelten zu erfahren, war ich erstaunt, auf welch ausgebaute und innerlich hoch besetzte Systeme von Tagträumen und Fantasiewelten ich gestoßen bin, sobald ich mich für deren Existenz zu interessieren begann.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree