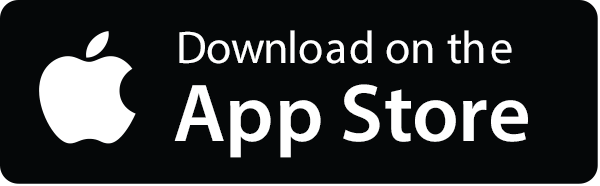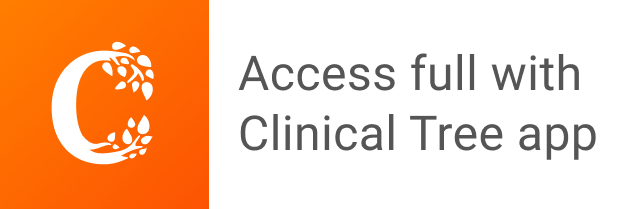Holger SalgeAnalytische Psychotherapie zwischen 18 und 252013Besonderheiten in der Behandlung von Spätadoleszenten10.1007/978-3-642-35357-4_5© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
5. Schwierigkeiten in der Diagnostik und Indikationsstellung
(1)
Fachklinik f. analytische Pschotherapie, Sonnenberg Klinik, Christian-Belser-Str. 79, 70597 Stuttgart, Deutschland
Zusammenfassung
Über die Schwierigkeiten in der Diagnostik spätadoleszenter Patienten, insbesondere unter dem Aspekt einer beginnenden Persönlichkeitsstörung , ist vielfältig berichtet worden (Bohleber 1981). Dennoch soll die seit Jahrzehnten geführte Diskussion, ob und anhand welcher Kriterien schon bei jungen Patienten die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung gestellt werden darf oder sogar soll, kurz angeschnitten werden. Auch wenn das Pendel in dieser Diskussion aktuell eher in Richtung der Bejahung dieser Frage auszuschlagen scheint, möchte ich beide Seiten der Kontroverse kurz zu Wort kommen lassen.
„Diese eigene Unsicherheit reibt einen innerlich wund. Bis in die Träume hinein verfolgt einen das. Was bist Du eigentlich, Max? Wozu taugst du denn, Max? Kann man Dich überhaupt brauchen auf dieser Welt, Max?“
Max Frisch
5.1 Diagnostik
Über die Schwierigkeiten in der Diagnostik spätadoleszenter Patienten, insbesondere unter dem Aspekt einer beginnenden Persönlichkeitsstörung , ist vielfältig berichtet worden (Bohleber 1981). Dennoch soll die seit Jahrzehnten geführte Diskussion, ob und anhand welcher Kriterien schon bei jungen Patienten die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung gestellt werden darf oder sogar soll, kurz angeschnitten werden. Auch wenn das Pendel in dieser Diskussion aktuell eher in Richtung der Bejahung dieser Frage auszuschlagen scheint, möchte ich beide Seiten der Kontroverse kurz zu Wort kommen lassen.
Auf der einen Seite steht die Position, die betont, dass die Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur als ein das gesamte Leben überdauernder Prozess einzuschätzen ist, welcher sich in verschiedenen Lebensabschnitten und unter unterschiedlichen Lebensumständen jeweils dynamisch ausgestaltet und die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung in dieser Entwicklungsphase letztlich nicht erlaubt. Auf der anderen Seite wird die Haltung vertreten, dass eine entsprechende frühzeitige Diagnosestellung nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig ist, um frühzeitig eine spezifische Therapie einzuleiten (Schlüter-Müller et al. 2009).
Borderlineproblematik
Besonders intensiv wird diese Diskussion rund um die Borderlineproblematik geführt. Dabei erscheint die Auseinandersetzung um diese Frage mitunter wie der Streit um des Kaisers Bart. An dem häufigen Auftreten von Borderlinephänomenen bei Adoleszenten, Spätadoleszenten und jungen Erwachsenen besteht sicherlich kein Zweifel. Und diese erfordern in der Regel eine Behandlung, unabhängig davon, ob sie im Rahmen einer schweren und protrahiert verlaufenden Adoleszenzkrise oder als Ausdruck einer beginnenden Persönlichkeitsstörung interpretiert werden.
Diagnostische Einschätzungen zielen nicht nur auf die Feststellung von Krankheitssymptomen und deren Bündelung mit Blick auf die Formulierung einer diagnostischen Entität, die durch die aktuellen Diagnosesysteme vorgegeben werden. Diagnostik im Kontext der psychotherapeutischen Arbeit mit jungen Patienten bedeutet auch immer die solide Einschätzung des Verlaufs der bisherigen adoleszenten Entwicklung und des aktuellen Reifegrads. Diese Einschätzung ist deshalb so wichtig, weil die Realisierbarkeit von Therapiezielen unmittelbar mit dem Reifegrad der inneren Persönlichkeitsentwicklung korrespondiert.
Die Problematik des komplexen diagnostischen Prozesses mit der schwierigen Gewichtung der beobachteten Phänomene wird auch bei der Einschätzung der Krankheitswertigkeit, der Frage nach der grundsätzlichen Behandlungsnotwendigkeit, der Differenzierung zwischen einem ambulanten oder stationären psychotherapeutischen Vorgehen oder der notwendigen stationären Behandlungsdauer Spätadoleszenter und junger Erwachsener relevant. Seitens der medizinischen Dienste der Kostenträger erfolgt zunehmend häufiger die Feststellung einer primären Fehlbelegung bei psychotherapeutischen Krankenhausbehandlungen mit dem gleichzeitigen Verweis auf eine Behandlungsindikation für andere Institutionen, bevorzugt Einrichtungen für medizinische oder berufliche Rehabilitationsbehandlungen.
Fallvignette
Der 22-jährige Patient Herr P. leidet seit fünf bis sechs Jahren an einer somatoformen Funktionsstörung des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes. Gleichzeitig ergeben sich viele Hinweise auf das Vorliegen einer sozialphobischen Entwicklung. Diese Symptomatik entwickelte sich kurz nach dem Tod des Vaters, als der Patient 16 Jahre alt war. Zudem besteht eine Adipositas per magna. Bei genauer Erhebung der Anamnese wird allerdings erkennbar, dass Herr P. schon vor dem ersten Auftreten der körperlichen Symptome Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen hatte und keine echte Anbindung an eine Peergroup gelungen war. Seine ab der Pubertät ausgesprochen starke Orientierung an die Familie, bei gleichzeitigem Meiden von sozialen Kontakten, rationalisierte er mit seinem Verantwortungsgefühl den jüngeren Geschwistern gegenüber. Das Scheitern bei dem Versuch, nach der mittleren Reife eine Ausbildung aufzunehmen oder die schulische Qualifikation voranzutreiben, und auch die zunehmende Stabilität seines Rückzugsarrangements mit nur sporadischen Kontakten zu einem männlichen Freund begründete er mit dem stereotypen Verweis auf die Unberechenbarkeit seiner somatischen Symptombildungen. Zwei eher halbherzige Versuche der Aufnahme einer ambulanten Psychotherapie scheiterten rasch. Nach mehrjährigem Verlauf entschloss er sich schließlich, mitbedingt durch den zunehmenden Druck seines Umfelds, eine stationäre psychotherapeutische Behandlung zu wagen. Im Verlauf dieser Behandlung, die durch einen hohen gruppentherapeutischen Anteil geprägt ist, tritt sehr rasch die komplexe Problematik des Patienten in Erscheinung. Die zugrunde liegende, ausgeprägte Identitätsunsicherheit des Patienten manifestiert sich in einem massiv eingeschränkten Kontaktverhalten den anderen Gruppenmitgliedern gegenüber. Gleichzeitig werden erhebliche Defizite in zentralen Ich-Funktionen, besonders der Spannungs- und Frustrationstoleranz, aber auch der Realitätsprüfung, evident. Auf jede Unsicherheit mobilisierende Erfahrung im Klinikalltag reagiert der junge Mann zunächst mit einer Zunahme seiner Abdominalbeschwerden und Rückzügen auf sein Zimmer. Auf diese Weise dokumentiert er, wie wenig er in der Lage ist, alltäglichen Anforderungen zu begegnen. Die Voraussetzungen, von einer medizinischen Rehabilitationsbehandlung zu profitieren, sind ganz offenkundig nicht einmal in Ansätzen gegeben. Dennoch kommt der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) zu der Einschätzung, dass eine stationäre Psychotherapie nicht indiziert sei. Es ist nicht möglich, die ausgeprägte Krankheitswertigkeit, die Ich-Syntonizität der Verhaltensweisen und damit verbunden auch die heimliche Idealisierung seines Lebensarrangements zu verdeutlichen.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree