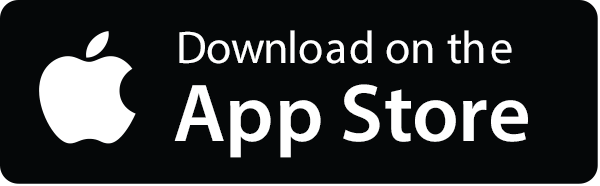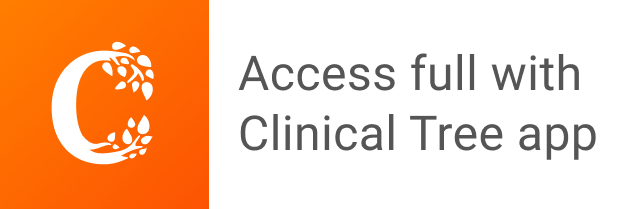Zusammenfassung
Westliche Gesellschaften durchlaufen strukturelle Veränderungsprozesse in kontinuierlich steigender Geschwindigkeit. Diese Veränderungsprozesse beziehen sich sowohl auf soziale Strukturen, und damit auch auf das Verhältnis der Generationen zueinander,als auch auf die ökonomische und technologische Entwicklung.
„Wir beneiden unsere Eltern um ihre Vergangenheit. Denn sie waren dabei, damals, in einer ganz anderen Zeit.“
Nina Pauer
Westliche Gesellschaften durchlaufen strukturelle Veränderungsprozesse in kontinuierlich steigender Geschwindigkeit. Diese Veränderungsprozesse beziehen sich sowohl auf soziale Strukturen, und damit auch auf das Verhältnis der Generationen zueinander,als auch auf die ökonomische und technologische Entwicklung.
Sozialisation unter veränderten Bedingungen
Kindliche und auch spätere Sozialisationsprozesse finden somit unter diesen veränderten Bedingungen statt. Bei einer postulierten kontinuierlichen Zunahme (oder stärkeren Demaskierung) psychischer Erkrankungen in den zurückliegenden zwei bis drei Jahrzehnten entsteht der Eindruck, dass die Zahl junger Menschen, die die im Übergang zum Erwachsenwerden anstehenden Entwicklungsaufgaben nicht hinreichend bewältigen, zunimmt. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass sich die Phänomenologie der Krankheitsbilder bzw. die Manifestationsformen dieses Scheiterns möglicherweise ändern. Bei einer seit Jahrzehnten stetig zunehmenden Verlängerung des „psychosozialen Moratoriums “ gibt es doch gleichzeitig Hinweise für die Annahme, dass die Nutzung dieser Lebensphase für die eigene Identitätsstabilisierung erschwert ist. Am Ende stehen vermehrt junge Menschen, die entweder an einer Position des Scheiterns festhalten oder aber sich dem Druck zur frühzeitigen inneren Ausrichtung und Festlegung im Sinne einer erzwungenen Identität unterworfen haben.
Die individuelle Entwicklung von Persönlichkeit und Identität findet selbstverständlich immer unter dem Einfluss der aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten statt, wird insofern geprägt von den vielfältigen Aspekten des jeweils vorherrschenden Zeitgeist es. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt nicht auf der Darstellung der sozialen Bedingungen, unter denen Erwachsenwerden heutzutage stattfindet. Dennoch nehmen die aktuellen Veränderungen in der westlichen Welt, die in den letzten Jahren bevorzugt unter den Überschriften Globalisierung, Beschleunigung, digitales Zeitalter etc. beschrieben und diskutiert werden, in hohem Maße Einfluss auf Wahrnehmungsmuster, Beziehungsverhalten, Erlebnisverarbeitung und – im Zusammenhang mit der Thematik dieses Buches besonders bedeutsam – auch auf Identitätsentwicklungen . Nicht nur die Beziehungen der Generationen zueinander werden infrage gestellt, sondern auch die Beziehung des Einzelnen zu sich selbst erfährt eine tief greifende Veränderung.
Die Mitglieder der postmodernen Gesellschaft, insbesondere die aktuell jungen Erwachsenen, sehen sich mit komplexen, häufig auch widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert. Je nach sozialer Herkunft in der Primärfamilie noch in der intensiven Begegnung mit „alten Werten“ wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Disziplin, Verbindlichkeit, Solidarität und Hilfsbereitschaft aufgewachsen, dringt die moderne Welt unter anderem in Form des technologischen Fortschritts bis in die Kinderzimmer vor und fordert die Identifizierung mit „neuen Werten“. Um in der Postmoderne bestehen zu können, erscheinen Flexibilität, Mobilität, die ständige Bereitschaft zur Innovation und Optimierung, Spontanität sowie Kompetenzen zur unmittelbaren Problemlösung als unverzichtbare persönliche Eigenschaften.
Wie schon angedeutet, gehört die Annahme eines grundsätzlichen Spannungsverhältnisses zwischen dem Einzelnen und seinem kulturellen Umfeld zu den Grundvoraussetzungen psychoanalytischer Theoriebildung. Insofern bilden Zeit und Zeitgeist eine relevante Determinante für die jeweiligen Entwicklungsbedingungen des Einzelnen. Aus soziologischer Perspektive führt die Beschleunigung als zentrales Merkmal der späten Moderne auch zu einer Labilisierung des Konzepts der stabilen personalen Identität und mündet in das Konzept der „situativen Identität “ (Rosa 2005, S. 362). Naturgemäß wird ein Soziologe mehr die Macht und Einflussmöglichkeiten der gesellschaftlichen Bedingungen auf den Einzelnen beleuchten, ein Psychotherapeut und insbesondere ein Psychoanalytiker die Stabilität und Beharrlichkeit innerer seelischer Strukturen, die sich lebensgeschichtlich entwickelt haben, fokussieren. Dennoch werden durch die unzweifelhaft veränderten Bedingungen, unter denen frühkindliche, aber auch adoleszente und spätadoleszente Sozialisation heute stattfinden, relevante Fragen aufgeworfen, deren Beantwortung sicherlich aussteht.
Zunahme von Identitätsunsicherheiten
Seit den 1970er-Jahren zeigt sich eine sukzessive Veränderung in den Biografien beim Übergang in das Erwachsenenalter. In einer ersten Annäherung lässt sich zunächst eine Verlängerung dieser Lebensphase ausmachen. Gleichzeitig gehen die Entwicklung und Reifung in sozialer, intellektueller, beruflicher, sexueller und ökonomischer Hinsicht nicht mehr Hand in Hand, sondern erscheinen in der individuellen Biografie zunehmend desynchronisiert. Die Kriterien für das Erwachsengewordensein werden gleichzeitig zunehmend verwischt. Die Differenzierung zwischen notwendigen Aufschubphasen, um sich in einer komplexer gewordenen Gesellschaft als Folge des gesellschaftlichen Strukturwandels zu orientieren, und sich konstituierenden Identitätsstörungen bzw. eindeutig pathologischen Entwicklungen bis hin zur beginnenden Manifestation von Persönlichkeitsstörungen – schon immer eine diagnostische Herausforderung – fällt demzufolge zunehmend schwerer.
Empirische Untersuchungen verweisen auf eine deutliche Zunahme von Identitätsunsicherheiten bei jungen Erwachsenen innerhalb weniger Jahrzehnte (Kraus u. Mitzscherlich 1998). Eine große Metaanalyse aus dem Jahre 2010 verweist auf den bemerkenswerten Befund, dass lediglich 47 % der 36-Jährigen auf eine stabile, erarbeitete Identität zurückgreifen können (Kroger et al. 2010). Wenn man zunächst darauf verzichten möchte, eine zumindest besorgniserregende Entwicklung in weiten Teilen einer Generation zu vermuten, könnte der mit der Identitätsunsicherheit verbundene Verzicht auf Festlegungen und Positionierungen doch auf Konzepte wie die von Rosa postulierte „situative Identität“ verweisen. Diese wäre dann weniger als Manifestation von pathologischen Entwicklungen zu interpretieren, sondern im Sinne eines sinnvollen, adaptiven Vorgangs an veränderte gesellschaftliche Umgebungsbedingungen. Eine andere Perspektive könnte allerdings auch eine gesellschaftlich geleugnete und damit weitgehend unbemerkt stattfindende regressive Bewegung von weiten Teilen einer Generation unterstellen.
Lebenshaltung der heute 20- bis 30-Jährigen
Häufig anzutreffende Schlagworte für die Lebenshaltung und -orientierung der Generation der heute 20- bis 30-Jährigen wie „Hotel Mama“, „Generation vielleicht“, „Generation Praktikum“ oder noch aktueller „Generation Konjunktiv“ haben Konjunktur. Sie sind am besten verständlich unter Bezugnahme auf die kulturtheoretischen Perspektiven von Erdheim (1993b, 2002). Während in den 1960er-, 1970er- und auch 1980er-Jahren der Generationsgegensatz offen zutage trat und mit der Studentenbewegung, der Friedensbewegung und der grün-alternativen Bewegung soziale Bewegungen mit nachhaltiger Einflussnahme auf die gesellschaftliche Gegenwart und Entwicklung entstanden sind, erleben junge Menschen die umgebende Welt heute wohl häufig als (über-)fordernd, fremd und rasant, aber auch als unübersichtlich und unverbindlich. Die Richtungen der Bewältigungsversuche sind vielfältig. Neben dem Drang zur zwanghaft anmutenden und konsequenten Selbstoptimierung lassen sich Hinwendungen zu konservativen Identifizierungsangeboten, aber auch zu anderen politischen, religiösen oder subkulturellen Gruppierungen ausmachen. Die literarische Selbstdiagnose einer Spätadoleszenten, aufgezeichnet in dem Buch Wir haben keine Angst, weist auf die tief sitzende Angst vor der falschen Entscheidung und auf ein Leben im Konjunktiv der heute 20- bis 30-Jährigen hin (Pauer 2011). Das politisch interessierte und handelnde Subjekt wird seltener, soziale Bewegungen mit dem Versuch nachhaltiger Einflussnahme auf die gesellschaftliche Realität gewinnen nicht wirklich an Kraft und bleiben oft Fragment.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree