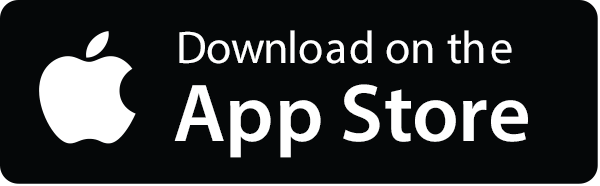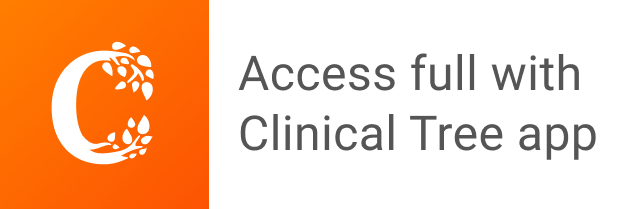Begriff
Erläuterung
Prävalenz
Krankenbestand, d. h. zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegende Zahl Erkrankter
Inzidenz
In einem Beobachtungsintervall aufgetretene Zahl neu Erkrankter
Letalität
Zahl der an einer bestimmten Erkrankung Gestorbenen bezogen auf die Gesamtheit der daran Erkrankten
Mortalität
Sterblichkeit: Anzahl der allgemeinen Sterbefälle bezogen auf eine bestimmte Zahl der Bevölkerung
Sensitivität
Gütekriterium für diagnostische Verfahren: Maß dafür, wie viele Kranke tatsächlich als krank erkannt werden
Spezifität
Gütekriterium für diagnostische Verfahren: Maß dafür, wie viele der Gesunden als gesund erkannt werden
2.2.4 Prävention
Der Prävention wird in unserem Gesundheitswesen eine immer größere Bedeutung beigemessen, so z. B. im erweiterten Präventionsauftrag der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 20 SGB V), mit dem die primäre Prävention gefördert werden soll. Man unterscheidet – je nach Zeitpunkt einer Intervention – drei Ebenen der Prävention, nämlich Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. In ◘ Tab. 2.2 werden diese Ebenen in übersichtlicher Form mit Beispielen aufgeführt (Niehoff 2006; Walter 2002; Harms 1998).
Tab. 2.2.
Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention
Intervention | Erläuterung | Beispiel |
|---|---|---|
Primärprävention | Eingreifen in Krankheitsursachen (Ätiologie) | Aufklärungskampagnen über gesunde Lebensweise (Ernährung und Sport), um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern |
Sekundärprävention | Eingreifen in die Krankheitsentstehung (Pathogenese) | Früherkennung und Behandlung von Gefäßrisikofaktoren (Hypertonie, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Vorhofflimmern), um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern |
Tertiärprävention | Eingreifen in Krankheitsfolgen und das Voranschreiten einer Erkrankung (Krankheitsverlauf) | Rehabilitation nach Schlaganfall oder Herzinfarkt |
2.2.5 System der sozialen Sicherung
Neben den fünf Säulen der sozialen Sicherung,
der Rentenversicherung (SGB VI),
der Unfallversicherung (SGB VII),
der Arbeitslosenversicherung (SGB III),
der Kranken- (SGB V) und Pflegeversicherung (SGB XI),
existieren noch Leistungen für Personengruppen, die durch die Sozialversicherung unzureichend abgesichert sind. Diese werden geregelt durch
das Bundesversorgungs- und Opferentschädigungsgesetz (Beamte, Wehrdienstleistende, Opfer von Gewaltverbrechen),
das Bundessozialhilfegesetz (Sicherung eines Existenzminimums) und
das Schwerbehindertengesetz.
Die Sozialversicherungen folgen zum größten Teil dem Solidaritätsprinzip, d. h., die Beitragsbemessung erfolgt unter Berücksichtigung des Einkommens, und die Versichertengemeinschaft trägt dafür Leistungen im Bedarfsfall. Insbesondere bei der Sozialhilfe greift aber noch das Subsidiaritätsprinzip, d. h., bevor die Solidargemeinschaft eintritt, muss zunächst geprüft werden, ob der Betroffene bzw. seine Familie nicht selbst für die Existenzsicherung aufkommen können.
2.2.6 Pflegebedürftigkeit
Die gesetzliche Pflegeversicherung ist rechtlich eigenständig, aber in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) integriert („unter einem Dach“). Wie die GKV hat sie einen Sicherstellungsauftrag, d. h., sie muss für eine bedarfsgerechte Versorgung eintreten. Bei der Entlassung von Frührehabilitanden entsteht die Frage nach der Pflegebedürftigkeit i.R. des Entlassungs- bzw. Überleitungsmanagements.
Pflegebedürftigkeit liegt dann vor, wenn Personen wegen einer Krankheit oder Behinderung in den Aktivitäten des täglichen Lebens auf Dauer (mindestens für 6 Monate) in erheblichem Maß auf Hilfe angewiesen sind (nach § 14 SGB XI).
In der Regel stellt der Sozialdienst der Frührehabilitationseinrichtung einen Antrag auf Pflegeleistungen bei der jeweiligen Pflegekasse. Diese wiederum beauftragt den MDK, eine Prüfung der Pflegebedürftigkeit vorzunehmen, entweder per Aktenlage oder durch persönliche Begutachtung. Bei Entlassung aus einer Klinik besteht auch die Möglichkeit der Schnelleinstufung, wobei zunächst vorläufig die Pflegestufe I festgelegt wird. Die Pflegestufen sind in ◘ Tab. 2.3 dargestellt. Sozialrechtlich wichtig ist, dass
Tab. 2.3.
Pflegestufen
Pflegestufe | Erläuterung |
|---|---|
I | Erhebliche Pflegebedürftigkeit: Durchschnittlicher Hilfebedarf mindestens 90 Minuten pro Tag, wovon auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten täglich entfallen müssen |
II | Schwerpflegebedürftigkeit: Durchschnittlicher Hilfebedarf mindestens 180 Minuten pro Tag, wovon auf die Grundpflege mehr als 120 Minuten täglich entfallen müssen |
III | Schwerstpflegebedürftigkeit: Durchschnittlicher Hilfebedarf mindestens 300 Minuten pro Tag, wovon auf die Grundpflege mehr als 240 Minuten täglich entfallen und auch nachts (zwischen 22 und 6 Uhr) regelmäßig Grundpflegebedarf vorliegen muss |
die Pflegeversicherung für die Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung zuständig ist und
die GKV für die Maßnahmen der Behandlungspflege (z. B. Injektionen oder Verbandswechsel).
Eine Erläuterung der Begriffe „Grund- und Behandlungspflege“ findet sich in ▶ Kap. 5.
2.2.7 Sozialmedizinische Beurteilung und Begutachtung
Auch bei Frührehabilitanden kann eine Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) für die gesetzliche Unfallversicherung erforderlich werden oder eine Einschätzung der Erwerbsminderung für die Rentenversicherung. Daher soll in ◘ Tab. 2.4 kurz auf diese Grundbegriffe eingegangen werden. Bei der Beurteilung der MdE spielt die Kausalität (Kausalitätsprinzip) eine entscheidende Rolle. Die gesetzliche Unfallversicherung würde z. B. eintreten, wenn eine intrakranielle Blutung i.R. eines Unfalls aufgetreten ist, nicht jedoch, wenn die intrakranielle Blutung spontan war und es dadurch zu einem Unfall kam (Entstehung aus „innerer Ursache“). Im Gegensatz dazu gilt in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung das Finalitätsprinzip, d. h., der eingetretene Gesundheitsschaden und dessen Folgen werden unabhängig von der Ursache betrachtet.
Tab. 2.4.


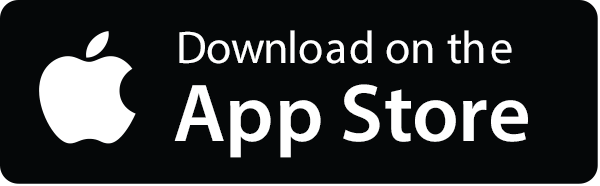

Grundbegriffe in der sozialmedizinischen Begutachtung
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree