Abb. 20.1.
Liderkrankungen
20.2.1.1 Ptosis
20.2.1.2 Horner-Syndrom
Beim Horner-Syndrom ist die Ptosis (◘ Abb. 20.2) mit einer engeren Pupille vergesellschaftet, die sich bei Abdunkelung nicht erweitert.


Abb. 20.2.
Ptosis rechts
20.2.1.3 Okulomotoriusparese
Eine Ptosis ist fast immer bei einer Okulomotoriusparese zu finden, wobei oftmals die Pupille weiter ist als auf der Gegenseite (parasympathische Lähmung). Bei kompletter Ptosis stören keine Doppelbilder. Wenn sich die Parese jedoch zurückbildet und somit die Lidspalte größer wird, kommt es in den meisten Fällen zur Diplopie, da der Augapfel in Divergenz steht.
Um in der Frührehabilitation beim Treppensteigen Treppenstürze zu vermeiden, sollte bei guter Mobilität der Patienten mit einer Augenmuskelparese wegen der Doppelbilder eine Augenklappe getragen werden.
20.2.1.4 Myasthenia gravis
Bei Myasthenia gravis ist häufig eine Ptosis anzutreffen, welche im Laufe des Tages zunimmt. Um festzustellen, ob eine Ptosis schon lange besteht oder neu aufgetreten ist, sollte man ältere Fotos oder Passbilder einsehen.
20.2.1.5 Lidödem
20.2.1.6 Allergisches Ödem
Ein allergisches Ödem zeigt sich als Wasseransammlung im Oberlid, meist ohne Rötung. Therapieempfehlung sind antiallergische Augentropfen.
20.2.1.7 Ödem nach Schädeloperation
Bei einem Ödem nach Schädeloperation ist keine Augentherapie möglich.
20.2.1.8 Entzündung
Eine Entzündung bei Hordeolum oder Chalazion kann eine Lidschwellung verursachen. Manchmal weist auch das nicht betroffene Partnerauge eine Lidschwellung auf, wenn bei Lagerungswechsel das Gewebewasser des Kopfes unter der Haut über die Nasenwurzel zur Gegenseite läuft. Als therapeutische Maßnahme sind antibiotische Augentropfen, evtl. mit einem steroidhaltigen Mittel kombiniert, angezeigt. Diese bringen oftmals Linderung der Beschwerden, können aber ein Chalazion nicht beseitigen (◘ Abb. 20.3).


Abb. 20.3
a, b. Lidödeme bei a Unterlidchalazion, b Oberlidhordeolum
20.2.1.9 Entropium
20.2.1.10 Altersbedingtes Entropium
Das altersbedingte Entropium (◘ Abb. 20.4) betrifft vor allem das Unterlid, wobei das eingerollte Lid mit den Wimpern (Pseudotrichiasis) dauerhaft auf dem Bulbus reibt. Dabei kommt es zu vermehrter Schleimbildung (schlechtes Sehen) und später zu Hornhautläsionen, die im schlimmsten Fall in einem Ulcus corneae enden.
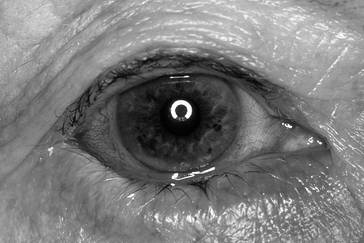
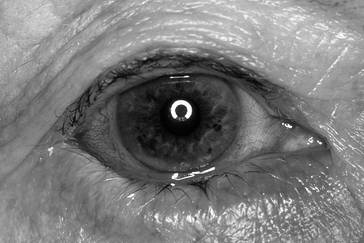
Abb. 20.4.
Entropium spasticum
Therapie
Temporäre Behandlung ist die Gabe von gelartigen Filmbildnern oder Augensalben.
Man kann auch eine Chemodenervierung des N. orbicularis mit einer Botulinustoxininjektion versuchen.
Bisweilen hilft das Kleben von Pflasterstreifen von der Unterlidkante bis zur Wange, um die Wimpern von der Hornhaut wegzuziehen. Damit erreicht man oftmals eine Linderung des Fremdkörpergefühls.
Meist jedoch kommt für die dauerhafte Behebung der Beschwerden nur ein chirurgisches Vorgehen infrage.
20.2.1.11 Narbenentropium
Das Narbenentropium kann nach Gesichtsverletzungen entstehen. Therapeutisch kann man versuchen, die Wimpern mit einer therapeutischen Kontaktlinse von der Hornhaut fernzuhalten. Oftmals ist ein chirurgisches Vorgehen vonnöten (Tarsotomie oder Transplantation von Lippen-Mund-Schleimhaut ins Bindehautgebiet).
20.2.1.12 Ektropium
20.2.1.13 Altersbedingtes Ektropium
Das altersbedingte Ektropium (Schlaffheitsektropium) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Unterlidkante nicht mehr am Augapfel anliegt und damit ein Tränenfluss auftritt. Das untere Tränenpünktchen kann den Tränensee nicht mehr aufnehmen und abpumpen. Wenn die Tarsusbindehaut zu lange nach außen gekehrt ist, entsteht eine chronische Entzündung mit Rötung und Krustenbildung (◘ Abb. 20.5 a).
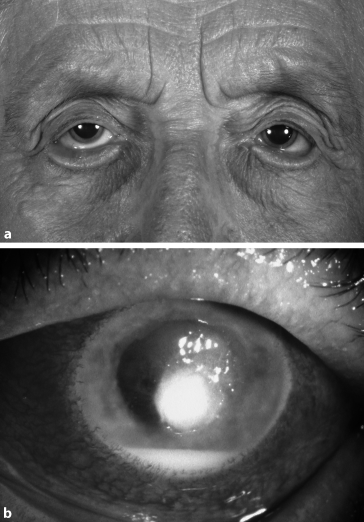
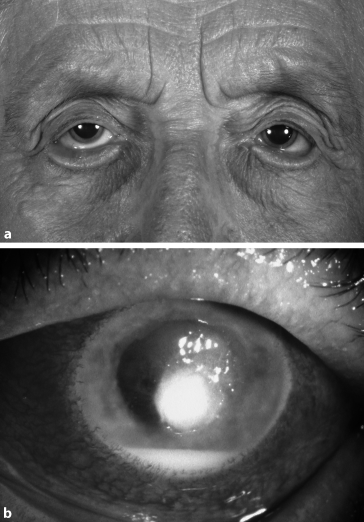
Abb. 20.5
a Beidseitiges seniles Ektropium. b Hornhautulkus mit Hypopyon (Eiterspiegel)
20.2.1.14 Narbenektropium
Das Narbenektropium kann nach Gesichts- und Lidverletzungen entstehen. Hierbei gilt das gleiche wie für das altersbedingte Ektropium.
20.2.1.15 Paralytisches Ektropium
Das paralytische Ektropium ist die Folge einer ipsilateralen Fazialisparese, wobei der Lidschluss des Oberlids inkomplett ist und das Unterlid nicht mehr am Bulbus anliegt. Bei ungenügendem Bell-Phänomen und Lagophthalmus entsteht in den meisten Fällen eine Expositionskeratopathie (Keratitis è lagophthalmo) bis hin zum Hornhautulkus (◘ Abb. 20.5 b), das vorwiegend im unteren Hornhautdrittel auftritt.
Der dazugehörige Tränenfluss bildet eine gewisse Schutzfunktion für die Hornhaut. Er entsteht durch den mangelhaften Tränenpumpmechanismus und die falsche Position des unteren Tränenpünktchens.
Therapie
Die Therapie des Ektropiums besteht in der Frührehabilitationsphase darin, die Befeuchtung der Hornhaut und Lidbindehaut mit Tränenersatzmitteln (gelartige Augentropfen oder Augensalben) zu gewährleisten.
Bei der Fazialisparese ist oftmals eine „feuchte Kammer“ mittels Uhrglasverband nötig, manchmal nur zur Nacht (Lidschlusskontrolle beim schlafenden Patienten), manchmal auch als Daueruhrglasverband (bei vorhandenen Hornhautschäden). Da sich in dem Milieu der „feuchten Kammer“ gern Bakterien vermehren, ist oftmals neben der befeuchtenden auch eine lokale antibiotische Therapie angezeigt.
Während das altersbedingte und Narbenektropium später chirurgisch behandelt werden könnten, ist bei lange andauerndem paralytischem Ektropium eine temporäre Tarsorrhaphie zu erwägen. Diese kann auch sinnvoll sein, wenn Patienten wegen Pflasterallergien den Uhrglasverband nicht vertragen.
Ob eine künstliche Ptosis mittels Botolinustoxininjektion herbeigeführt werden kann, um die Hornhaut durch das Oberlid abzudecken, muss von neurologischer Seite erwogen werden.
In jedem Fall sind augenärztliche Kontrollen notwendig, um den Hornhautbefund zu verfolgen, damit eine Hornhautperforation nach einem Hornhautulkus vermieden wird.
20.2.2 Bindehauterkrankungen
In ◘ Tab. 20.1 sind die Bindehauterkrankungen im Überblick dargestellt.
Tab. 20.1.
Bindehauterkrankungen („rotes Auge“)
Symptome
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel
Full access? Get Clinical Tree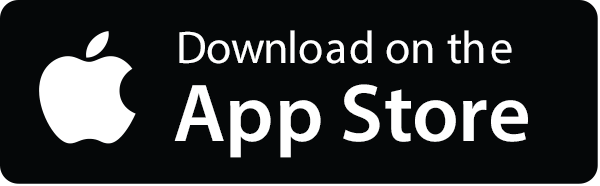
 Get Clinical Tree app for offline access
Get Clinical Tree app for offline access
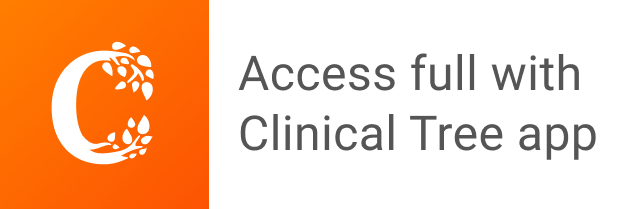
|
|---|





