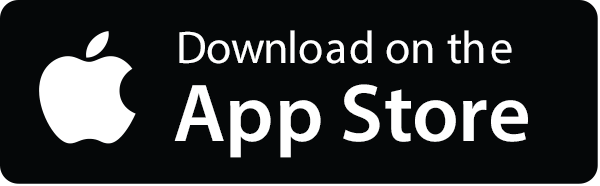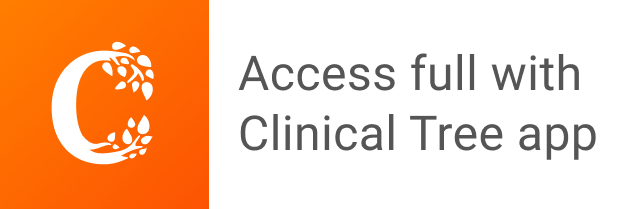Plastische Tracheostomie (= chirurgische Tracheostomie)
Dilatative Tracheotomie (= Punktionstracheotomie)
Vorgehen
Operativer Eingriff, bei dem die Kutis mit der Trachealschleimhaut fest vernäht wird
Punktion der Trachea unter bronchoskopischer Kontrolle, Aufdehnung; es entsteht ein offener Wundkanal
Indikation
Dauerhafte Versorgung wird angestrebt (HNO)
Temporär (Intensivstation)
Vergleich
– Stabil
– Großer Tracheostomiekanal (leichterer TK-Wechsel)
– Aufwändiger (OP)
– Nach Dekanülierung operativer Verschluss erforderlich
– Weniger stabil
– Kleiner Kanal (TK-Wechsel erschwert, Fehlplatzierung)
– Einfacher (Bedside)
– Nach Dekanülierung selbständiger Verschluss
13.2.2 Perkutane dilatative Tracheotomie
Die perkutane dilatative Tracheotomie ist demgegenüber ein mit deutlich geringerem Aufwand am Bettplatz durchzuführendes Verfahren. Der Eingriff wird überwiegend von Intensivmedizinern ausgeführt. Der gravierende Nachteil des Verfahrens ist das instabile Tracheostoma, das lediglich aus dem aufgeweiteten Punktionskanal besteht und sich daher bei Verlust der Trachealkanüle sehr schnell verschließt, (besonders in der frühen Phase [5–10 Tage nach Anlage des Tracheostomas], aber auch später, wenn der Stomakanal schon stabiler erscheint), so dass ein erneutes Einführen einer Trachealkanüle unmöglich sein kann.
Wenn ein Patient lebenslang oder für sehr lange Zeit mit einem Tracheostoma versorgt bleiben muss, ist die plastische Tracheostomie das Mittel der Wahl. Perkutane dilatative Tracheotomien müssen vor Entlassung des Patienten in ein plastisches Tracheostoma umgewandelt werden.
Die perkutane dilatative Tracheotomie sollte nur dann durchgeführt werden, wenn
die anatomischen Landmarken – Schild- und Ringknorpel sowie oberer Rand des Manubrium sterni bzw. Jugulargrube – sicher identifiziert werden können (◘ Abb. 13.1), und
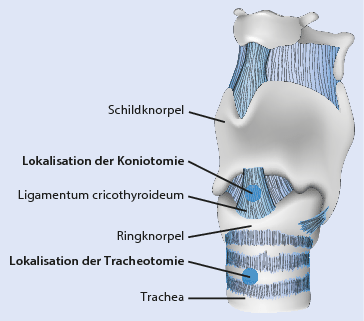
Abb. 13.1.
Anatomische Landmarken: Schild- und Ringknorpel sowie oberer Rand des Manubrium sterni bzw. Jugulargrube
eine ausreichende Diaphanoskopie zum sicheren Identifizieren der genauen Punktionsstelle möglich ist.
Des Weiteren muss ausreichend Platz für eine Punktion und das Platzieren der Trachealkanüle vorhanden sein. Weitere Kontraindikationen sind
eine ausgeprägte Gerinnungsstörung,
eine ausgeprägte Struma, die vor dem Eingriff sonographisch ausgeschlossen werden sollte,
infizierte Wunden im Bereich des OP-Gebiets sowie
anatomische Veränderungen im Bereich der oberen Atemwege wie Tracheomalazie oder Tumoren, die die Trachea miteinbeziehen.
Weiterhin sollte die Indikation zur dilatativen perkutanen Tracheotomie zurückhaltend gestellt werden, wenn es im OP-Gebiet bereits Voroperationen gab. Bei bereits bestehender Narbe ist die Dilatation des Punktionskanals schwieriger und das Risiko von Verletzungen v. a. der Hinterwand der Trachea deutlich erhöht.
13.2.2.1 Verfahren der dilatativen Tracheotomie
Es gibt eine Reihe von Verfahren zur dilatativen Tracheotomie, die sich als Standardmethoden durchgesetzt haben (▶ Übersicht 13.3).
Übersicht 13.3. Standardmethoden der dilatativen Tracheotomie
Methode nach Ciaglia, mit mehreren Dilatatoren ansteigender Größe als auch mit einem konischen Dilatator als Ein-Schritt-Dilatation
Methode nach Griggs
Methode nach Fantoni
PercuTwist-Verfahren
13.2.2.2 Platzierung der Trachealkanüle
Allen Verfahren gemeinsam ist die Punktion der Trachea mit einer scharfen dünnen Stahlkanüle unter tracheoskopischer Kontrolle. Die Punktion erfolgt zwischen dem 2.–4. Trachealring. Ist die Kanüle mittig in der Trachea platziert, wird darüber ein weicher Führungsdraht vorgeschoben. Außer bei der Methode nach Fantoni wird nun der Stichkanal von außen durch das Einführen von für die jeweilige Methode spezifischen Dilatatoren auf die Größe der Trachealkanüle aufgeweitet, wobei der Führungsdraht als Leitstruktur dient. Anschließend wird über den Führungsdraht die Trachealkanüle platziert. Während der gesamten Prozedur wird durch tracheoskopische Kontrolle sichergestellt, dass es nicht zu einer Dislokation des Führungsdrahts oder einer Verletzung von Strukturen der Trachea (insbesondere der Hinterwand) kommt. Ist die Trachealkanüle platziert, wird die korrekte Lage endoskopisch kontrolliert.
13.2.2.3 Dilatation des Stichkanals
Zur Dilatation des Stichkanals sind verschiedene Methoden verfügbar.
Methode nach Ciaglia
Die Methode nach Ciaglia gibt die Möglichkeit, mit verschiedenen Dilatatoren mit ansteigendem Durchmesser zu arbeiten oder mit einem konischen Dilatator, der bis zu einer Markierung, bei der der Stichkanal die Weite der später einzusetzenden Trachealkanüle erreicht hat, eingeführt werden muss. Wichtig dabei ist, den Stichkanal nach Einführen des Führungsdrahts vor dem Einsatz der Dilatatoren mit einer Stichinzision zu erweitern.
Eine Schwierigkeit aller Verfahren ist, dass das Einbringen der Dilatatoren immer mit Kraftanwendung einhergeht, die die Halsweichteile und die Trachea komprimiert, so dass die tracheoskopische Kontrolle des Vorgehens zeitweise sehr schwierig sein kann.
Verfahren nach Griggs
Bei dem Verfahren nach Griggs wird nach Einführen des Führungsdrahts und Stichinzision zunächst ein kleiner Dilatator eingeführt und anschließend eine Dilatationszange in geschlossenem Zustand am Führungsdraht entlang bis in die Trachea eingeführt. Durch Öffnen der Dilatationszange wird der Punktionskanal dann soweit aufgeweitet, dass die Trachealkanüle eingeführt werden kann.
PercuTwist-Verfahren
Das PercuTwist-Verfahren arbeitet mit einem Dilatator, der ein Gewinde trägt. Nach Punktion der Trachea, Einführen des Führungsdrahts und Stichinzision wird über den Führungsdraht der Dilatator eingeschraubt und nach Erreichen der Trachea in vollem Umfang wieder herausgeschraubt. Über den Führungsdraht wird dann die Trachealkanüle platziert. Beim PercuTwist-Verfahren kann während des Einschraubens des Dilatators weniger Druck auf die Halsweichteile ausgeübt werden. Dadurch bleibt die tracheoskopische Sicht besser erhalten.
Verfahren nach Fantoni
Bei dem Verfahren nach Fantoni wird ein grundsätzlich anderer Weg eingeschlagen. Nach Punktion der Trachea wird der Führungsdraht im Gegensatz zu den anderen angesprochenen Verfahren nicht in die Trachea vorgeschoben, sondern am endotrachealen Tubus vorbei oral ausgeleitet. Am Führungsdraht wird die Trachealkanüle befestigt und nach Extubation in Apnoe oder nach Umintubation auf einen dünnen Tubus in die Trachea und durch den Punktionskanal nach außen gezogen. Die Dilatation erfolgt dabei durch die Kanüle selbst und von innen nach außen. Die Kanüle muss jetzt noch um 180° in Richtung Bifurkation gedreht werden.
13.2.2.4 Beispiel: Perkutane dilatative Tracheotomie mit einem konischen Ein-Schritt-Dilatator
Im Folgenden wird eine perkutane dilatative Tracheotomie mit einem konischen Ein-Schritt-Dilatator vorgestellt.
Vorbereitung
Zur Vorbereitung wird eine Sonographie der OP-Region zur Identifizierung evtl. bestehender Kontraindikationen durchgeführt. Bei großer Struma oder großem Schilddrüsenisthmus sollte auf eine Punktionstracheotomie verzichtet werden, ebenso wenn die Sonographie große Blutgefäße im OP-Gebiet darstellt.
Nun wird die bestehende Analgosedierung des Patienten vertieft und zur Narkose komplettiert. Danach wird der Patient relaxiert.
Der Patient wird mit leicht überstrecktem Kopf gelagert. Zwischen den Schulterblättern wird ein zusammengerolltes Tuch oder ein flaches Lagerungskissen platziert. Dadurch wird der Situs etwas gestreckt, und vor allem bei kurzen Hälsen wird der Handlungsspielraum etwas größer.
Dann erfolgen die Desinfektion nach chirurgischen Kautelen und die Abdeckung des OP-Gebiets mit einem sterilen Klebetuch ausreichender Größe. Der Führungsdraht steht u. U. lang über und kann bei zu kleinen Abdecktüchern leicht unsteril werden (◘ Abb. 13.2).

Abb. 13.2.
Abdeckung. Nach Desinfektion des OP-Gebiets wird mit einem Klebetuch steril abgedeckt
Alle für den Eingriff benötigten Materialien werden steril bereitgestellt und in Griffweite des Operateurs platziert.
Die Beatmung wird auf eine druckkontrollierte Beatmungsform umgestellt. Bis zum Abschluss des Eingriffs wird mit reinem Sauerstoff weiterbeatmet. Durch das Bronchoskop wird ein erheblicher Teil des Atemwegs verlegt, dadurch werden die Hubvolumina deutlich kleiner. Eine Beatmung mit reinem Sauerstoff gibt eine Sicherheitsreserve bzgl. einer ausreichenden Oxygenierung des Patienten während des Eingriffs.
Nun werden die anatomischen Landmarken – Schild- und Ringknorpel sowie obere Begrenzung des Sternums bzw. das Jugulum – getastet, um die ungefähre Stichhöhe (zwischen der 2. und 4. Trachealspange) zu identifizieren.
Einführen der Punktionskanüle
Als Nächstes wird mit dem Bronchoskop in den endotrachealen Tubus eingegangen und das Bronchoskop bis zum Ende des Tubus vorgeschoben. Der Tubus wird entblockt und das ganze System bis zum Erreichen der Diaphanoskopie zurückgezogen. Dazu wird der Raum abgedunkelt.
Dann wird der Tubus wieder leicht geblockt, um die weitere Beatmung zu ermöglichen und eine massive Aspiration zu vermeiden. Das Bronchoskop wird soweit zurückgezogen, dass es mit der Tubusspitze abschließt. Bei überstehendem Bronchoskop besteht die Gefahr, das Gerät mit der Punktionskanüle zu beschädigen.
Die Punktionskanüle ist 14 G dick und besteht aus einem scharfen Stahlinnenteil und einer weichen, stumpfen Teflonaußenkanüle. Die komplette Kanüle wird senkrecht zur Haut in Richtung der Trachea vorgeschoben, bis die Teflonaußenkanüle mit dem Bronchoskop im Lumen zu sehen ist. Dann kann der scharfe Stahlinnenteil entfernt werden. In der Trachea verbleibt das Ende der weichen Außenkanüle (◘ Abb. 13.3).
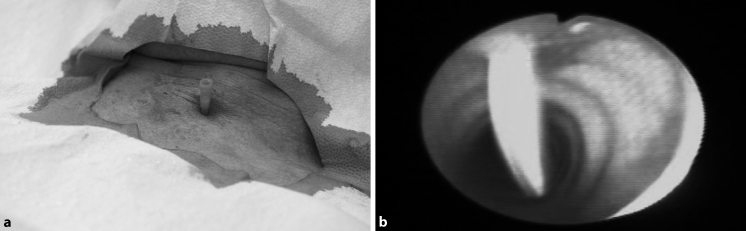
Abb. 13.3
a, b. Punktion der Trachea. a Punktionskanüle in situ, b Punktionskanüle in der Trachea
Durch die verbliebene Teflonaußenkanüle wird im nächsten Schritt der Führungsdraht eingeführt und in Richtung Bifurkation in die Trachea vorgeschoben. Anschließend kann der äußere Teil der Punktionskanüle ebenfalls entfernt werden. Für den weiteren Ablauf dient der Führungsdraht als Leitschiene (◘ Abb. 13.4).
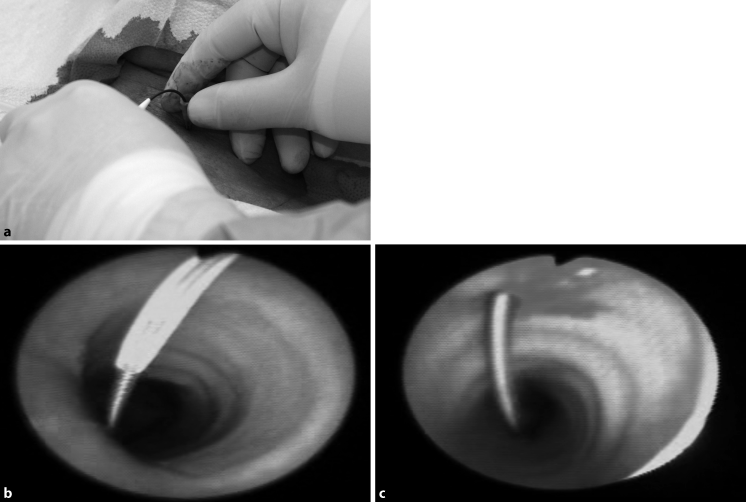
Abb. 13.4
a-c. Führungsdraht. a Einführen des Führungsdrahts durch die Punktionskanüle, b Einbringen des Führungsdrahts in der Trachea, c Führungsdraht in der Trachea nach Entfernen der Punktionskanüle
Dilatation des Stichkanals
Nach Entfernen der Punktionskanüle wird rechts und links des Führungsdrahts eine Stichinzision gemacht. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Gewebebrücke in der Mitte stehen bleibt. Sinn der Inzision ist es, das Einführen der Dilatatoren und der Trachealkanüle zu erleichtern. Dabei kann es zu Blutungen kommen, die aber im weiteren Verlauf des Eingriffs durch die Dilatatoren und die Trachealkanüle tamponiert werden.
Nun wird als Erstes ein kurzer 14-FR-Dilatator eingeführt und dadurch der Stichkanal auf das Einführen des konischen Dilatators vorbereitet. Es ist darauf zu achten, dass wie bei der Punktion die Richtung senkrecht zur Haut bis zum Erreichen der Trachea eingehalten wird (◘ Abb. 13.5).
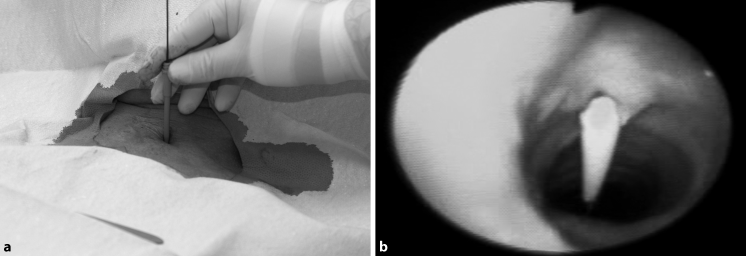
Abb. 13.5
a, b. 14-Fr-Dilatator. a Der 14-Fr-Dilatator wird über den Führungsdraht eingebracht, b 14-Fr-Dilatator in der Trachea
Einführen des Ein-Schritt-Dilatators
Der konische Ein-Schritt-Dilatator ist mit einer hydrophilen Gleitschicht versehen, die das Einführen durch den Punktionskanal erleichtert. Sie muss vor dem Einführen des Dilatators durch Benetzung mit Kochsalzlösung aktiviert werden.
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree